
Kontinuierlich werden anarchistische Kreise und Räume von sexualisierten Übergriffen bis hin zu Vergewaltigungen geplagt. Als Reaktion haben wir Konzepte entwickelt, wie wir gegenseitig Verantwortung ohne Einbeziehung des Staates übernehmen können. Aber warum laufen diese Konzepte nicht rund? Dieser Essay untersucht den Kontext, in dem sich die Modelle der ›Community Accountability‹1 entwickelt haben und analysiert die Tücken, auf die wir bei ihrer Anwendung gestoßen sind. Um aus den Sackgassen in unseren Szenen rund um sexualisierte Gewalt rauszukommen, müssen wir die Idee von Gemeinschaft selber hinterfragen und unserem Widerstand neue Richtungen geben.

[Diese Übersetzung ist ursprünglich in unserem Buch Writings on the Wall erschienen]
Einleitung
»Ich glaube nicht mehr an Accountability… meine Wut und meine Hoffnungslosigkeit über das aktuelle Modell sind inzwischen auf dem Niveau meiner Energie, die ich in der Vergangenheit darein investiert habe. Mein Verhältnis zur Accountability fühlt sich inzwischen wie das nach einer unglücklichen Trennung an… ich habe die letzten 10 Jahre wirklich alles versucht, damit die Beziehung funktioniert.«
— Angustia Celeste, “Safety is an Illusion: Reflections on Accountability”
Sexualisierte Gewalt zerreißt uns. Sie spaltet unsere Communitys, ruiniert Leben, sabotiert Projekte und Prozesse, verrät schlimme Widersprüche zwischen unseren angeblichen Idealen und unseren tatsächlichen Praktiken und hält ein Klima der Angst und Unterdrückung aufrecht, insbesondere für Frauen. Sexualisierte Gewalt ist politisch; sie ist eine Funktion des Patriarchats und nicht nur eine individuelle Verletzung, die einzelne Menschen (in der Regel Männer) anderen (meist Frauen) zufügen.
Sexualisierte Gewalt, Gewalt in Partnerschaften, Kindesmissbrauch und sexuelle Belästigung sind Methoden, durch die Männer physisch ihre Herrschaft über Frauen durchsetzen. Sexualisierte Gewalt trägt zur Aufrechterhaltung von Patriarchat, Heterosexismus, der Unterdrückung von trans Personen, Altersdiskriminierung und Unterdrückung der Jugend, rassistischem Kolonialismus und Genozid bei. Der Kampf gegen sexualisierte Gewalt ist essenziell für einen revolutionären Umbruch.
Das Modell der ›Community Accountability‹ ist eines der wichtigsten Instrumente, das Anarchist*innen in den letzten Jahren zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt eingesetzt haben. Der vorliegende Essay analysiert dieses Modell in der Hoffnung, eine ehrliche, selbstkritische Diskussion darüber zu provozieren, wie wir auf Übergriffe innerhalb anarchistischer Szenen reagieren – außerdem wollen wir uns vorstellen, wie wir weiterkommen könnten.
Dieser Artikel soll NICHT als Einleitung in die Prozesse der ›Community Accountability‹ dienen; er setzt voraus, dass du bereits etwas über diese Prozesse und wie sie funktionieren (oder nicht funktionieren) weißt. Er stützt sich speziell auf nordamerikanische anarchistische, Punk- und radikale aktivistische Subkulturen und setzt voraus, dass die Lesenden ihren Kontext und ihre Sprache verstehen. Der Großteil ist auch auf Erfahrungen innerhalb der europäischen radikalen Linken übertragbar. Am Ende des Textes findest du einige Lese-Empfehlungen, dort gibt es auch einleitende Texte. Wenn du dich als Anarchist*in verstehst und in deiner Szene Erfahrungen gesammelt hast, wie versucht wird, mit sexualisierter Gewalt umzugehen, womöglich unter Einbeziehung des ›Accountability‹ Konzeptes, ist der Artikel für dich bestimmt.
Rahmenbedingungen: Gender
Gender ist kompliziert; einige Leute, die wir als männlich oder weiblich wahrnehmen, identifizieren sich nicht auf diese Weise, und einige identifizieren sich weder mit dem einen noch dem anderen. Wenn wir uns auf ›Männer‹ oder ›Frauen‹ beziehen, meinen wir Leute, die sich auf diese Weise identifizieren, egal ob sie cis oder trans sind. Übergriffe können von allen gegenüber allen und über Gendergrenzen hinweg begangen werden; manchmal sind cis-Frauen, trans-Männer und -Frauen und genderqueere Personen übergriffig, und oft sind cis-Männer auch Betroffene. Indem wir dies anerkennen, wollen wir allerdings nicht die Tatsache in den Hintergrund drängen, dass die allergrößte Mehrheit der Menschen, die übergriffig werden, cis-Männer sind und die Mehrheit der Menschen, die sie verletzen und angreifen, Frauen sind.
Sexualisierte Gewalt ist nicht spezifisch einem Gender zuzuordnen, sie kann also nicht ausschließlich von Personen eines Genders ausgeübt werden und es sind nicht ausschließlich Personen eines Genders betroffen; allerdings sind sie auch nicht genderneutral, das Gender ist sowohl bei der betroffenen Person also auch bei der übergriffigen Person relevant. Wir müssen die genderspezifischen Muster von Übergriffen als Ausdruck patriarchaler Herrschaft verstehen, ohne dabei Beispiele außerhalb des üblichen Rahmens unsichtbar zu machen.
Restorative und Transformative Justice
Wenn wir über Prozesse der ›Community Accountability‹ sprechen, beziehen wir uns auf kollektive Bemühungen zum Umgang mit Verletzungen – in diesem Fall durch sexualisierte Gewalt –, die sich nicht auf Bestrafung oder juristische ›Gerechtigkeit‹ konzentrieren, sondern auf die Sicherheit der Betroffenen und die Infragestellung der zugrunde liegenden sozialen Muster und Machtstrukturen. Im einfachsten Fall könnte dies schlicht bedeuten, dass ein paar Freund*innen sich für eine*n einsetzen, der/die verletzt wurde: sie fragen, was er/sie braucht, und versuchen, diese Bedürfnisse gegenüber der Person, die sie verletzt hat, und innerhalb der gemeinsamen Community durchzusetzen. Einige Prozesse beinhalten eine Gruppe, die zwischen einem Individuum und der beschuldigten Person vermittelt, oder separate Gruppen für jede involvierte Person, die die Kommunikation zwischen ihnen erleichtern sollen.
Diese Prozesse beinhalten in der Regel die Festlegung von Bedingungen oder ›Forderungen‹ an die beschuldigte Person, um die Sicherheit oder das Vertrauen wiederherzustellen und zu verhindern, dass sie weitere Personen verletzt, sowie irgendeine Methode zur Nachbearbeitung, um sicherzustellen, dass diese Forderungen erfüllt werden. All diesen unterschiedlichen Ansätzen ist gemein, dass sie die entstandenen Verletzungen direkt und ohne Einbeziehung des Staates regeln.
Community Accountability spricht Anarchist*innen als Alternative zum kritisierten feindseligen Rahmen des strafrechtlichen Justizsystems und seiner ›Gerechtigkeit‹ an. In diesem Rahmen wird davon ausgegangen, dass zwei Konfliktparteien entgegengesetzte Interessen haben; der Staat betrachtet sich selbst als weitere geschädigte Partei und fungiert somit als Vermittler. ›Gerechtigkeit‹ bedeutet dann, dass entschieden wird, welche Person im Recht ist und welche Person die Konsequenzen zu tragen hat. Konsequenzen, die vom Staat bestimmt werden und in der Regel nichts mit dem tatsächlich angerichteten Schaden oder dessen Ursachen zu tun haben. Im Gegensatz dazu konzentriert sich Restaurative Justice (Wiederherstellende Gerechtigkeit) auf die Bedürfnisse der Betroffenen und derer, die Schaden angerichtet haben, und nicht auf die Notwendigkeit, die abstrakten Rechtsgrundsätze zu erfüllen oder eine Strafe zu verhängen. Betroffene spielen eine aktive Rolle bei der Beilegung von Streitigkeiten, während die gewaltausübenden Personen ermutigt werden, die Verantwortung für ihre Handlungen zu übernehmen und den entstandenen Schaden auszugleichen. Sie basiert auf einer Theorie der Gerechtigkeit, die ›Verbrechen‹ und Fehlverhalten als ein Vergehen gegen Einzelpersonen oder Gemeinschaften und nicht gegen den Staat sieht. Viele der derzeitigen Arbeitsmodelle für Restaurative Justice haben ihren Ursprung in den Gemeinden der Maori und der nordamerikanischen Indigenen.
Auf diesem Rahmen aufbauend, legt das Modell der Transformative Justice (Transformative Gerechtigkeit) den Fokus auf die Wiedergutmachung von Verletzungen (ohne sich dabei auf den Staat zu verlassen) und die Kritik an systemimmanenten Unterdrückungsmechanismen. Nach Generation Five, einer Organisation, deren Arbeit gegen sexuellen Missbrauch an Kindern auf diesem Modell basiert, sind die Ziele Transformativer Gerechtigkeit:
- Sicherheit, Heilung und Handlungsmacht der Überlebenden
- Verantwortungsübernahme und Transformation der Täter
- gemeinschaftliches Handeln, Heilen und gemeinschaftliche Verantwortungsübernahme
- Transformation der sozialen Bedingungen, die Gewaltverhältnisse aufrecht erhalten: Verhältnisse der Unterdrückung, Ausbeutung, Herrschaft und staatlicher Gewalt
Die anarchistische Praxis der Community Accountability beruht in der Theorie auf diesen grundlegenden Prinzipien, zusammen mit der DIY-Ethik und dem Schwerpunkt auf direktem Handeln.

Wo wir uns befinden
Anarchistische Community Accountability: Jüngste Geschichte und aktueller Stand der Dinge
Wie ist dieses Praxismodell, mit dem wir auf sexualisierte Gewalt reagieren, entstanden? In den 1990er und frühen 2000ern haben Frauen und Überlebende sexualisierter Gewalt auf verschiedene Arten reagiert: es wurden Zines hergestellt, in denen Täter benannt wurden, und diese auf Konzerten verteilt, es wurde sich untereinander ausgetauscht, es wurden Menschen in anderen Communitys vor Wiederholungstätern gewarnt und in einigen Fällen wurden Täter physisch angegangen. Das Hysteria Collective aus Portland stellte einen der frühen Versuche dar, sexualisierten Übergriffen strukturell etwas zu entgegnen, es erstellte und verteilte Literatur zu dem Thema, ging gegen übergriffige Männer in der Punk-Szene vor und organisierte eine Konferenz. In anderen Städten formierten sich Girl-Gangs zur Selbstverteidigung, die sich auf konfrontative Aktionen fokussierten. Meistens wurden solche Bemühungen jedoch isoliert, der Glaube an Vergewaltigungsmythen unter Anarchisten (insbesondere Männern) blieb bestehen, und Betroffene, die versuchten, über ihre Erfahrungen zu reden, wurden ignoriert, gemieden, abgewiesen; ihnen wurde vorgeworfen, die Aufmerksamkeit von wichtigeren Themen abzulenken oder für die Spaltung im Stil von COINTELPRO2 verantwortlich zu sein.
Als Reaktion darauf arbeiteten anarchistische Frauen (und andere*) daran, die anarchistische Szene für sexualisierte Gewalt zu sensibilisieren und eine Kultur des Konsenses zu etablieren. Ein Großteil dieser Ideen verbreitete sich durch Zines, insbesondere durch Cindy Crabbs »Doris« - und »Support«-Zines; es wurden aber auch Workshops auf Konferenzen organisiert, bei denen über Unterstützung von Betroffenen, Konsens und positive Sexualität debattiert wurde. Männergruppen organisierten sich gegen sexualisierte Gewalt in einigen Szenen, so wie das Kollektiv Dealing With Our Shit (DWOS) in Minneapolis 2002. Ein wichtiger Wendepunkt war das Pointless Fest 2004 in Philadelphia, bei dem die Organisator*innen öffentlich bekannt machten, dass drei Frauen während des Festes vergewaltigt worden waren. Sie gründeten Gruppen, um die Überlebenden zu unterstützen und um nach Wegen zu suchen, wie mit den Vergewaltigern umgegangen werden sollte. Diese Gruppen wurden zu Philly‘s Pissed und Philly Stands Up, zwei lange bestehenden Kollektiven, die zwar für sich stehen, aber eng zusammenarbeiten und sich der Unterstützung von Überlebenden und der Intervention gegen Täter widmen.
Übergriffe, Accountability und Konsens wurden auf nahezu allen anarchistischen Konferenzen und Treffen Thema. Viele Distros begannen, Zines zum Thema zu verbreiten, Bands sprachen auf der Bühne darüber und in vielen Städten gründeten sich Unterstützer*innen-Gruppen und Accountability Kollektive. Organisator*innen von Massenaktionen begannen mit der Entwicklung von Reaktionsplänen, die beim Gegengipfel zum G20 in Pittsburgh 2009 in einer umfassenden Infrastruktur zur Reaktion auf sexualisierte Übergriffe mündeten.
Wie stehen die Dinge also heutzutage? Begriffe wie ›Konsens‹, ›Tätervorwurf‹, ›Unterstützer*innen-Gruppe‹ und ›gewaltausübende Person‹ sind weit verbreitet, sie werden sogar zum Gegenstand von Witzen. Vielen Leuten wurde übergriffiges Verhalten vorgeworfen und Dutzende Prozesse der ›Community Accountabilty‹ finden statt. Es entwickelt sich Identitätspolitik rund um die Label ›Betroffene‹ und ›Täter‹ mit Szenen, die sich daran polarisieren. Trotz der Bemühungen, vor diesen Effekten zu warnen und alle Teilnehmenden an ›Community Accountability‹-Prozessen zu ermutigen, selbstkritisch zu bleiben, wurden diese Prozesse manchmal dazu benutzt, Macht auszuüben, Legitimität zu erlangen oder zu verweigern und Unterschiede in der Wahrnehmung auszulöschen.
Philly Stands Up setzt ihre Arbeit fort und wird zum Beispiel von Hochschulen dafür bezahlt, Schulungen nach ihrem Modell anzubieten, und fungiert als eine Art halbformelle Überwachungsorganisation von Tätern. Sie werden von Leuten aus dem ganzen Land kontaktiert, um diese über verschiedene laufende Prozesse zu informieren. In Zusammenarbeit mit anderen Transformative-Justice-Gruppen haben ihre Leute beim US Sozialforum in Detroit gearbeitet und 2011 ein dreitägiges Training für Community-Accountability-Aktivist*innen organisiert. Es haben sich zahlreiche ähnliche Kollektive in den anarchistischen Szenen anderer Städte gebildet, aber wenige sind so langlebig und prominent wie PSU. Da sich immer mehr szeneninterne Kommunikation ins Internet verlagert, sind eine Reihe von Websites (vor allem anarchistnews.org) zu wichtigen Dreh- und Angelpunkten geworden, auf denen über die Politik rund um Übergriffe und Community Accountability getratscht und gelabert wird. Es sind auch Websites aufgetaucht, auf denen Informationen über spezifische Individuen, denen Übergriffe vorgeworfen werden, offengelegt werden.
Auf den meisten anarchistischen Treffen werden inzwischen Leitfäden zu Konsens und zum Umgang mit sexualisierten Übergriffen veröffentlicht, oftmals wird dabei betont, dass es auch eine Awareness-Struktur gibt. Basierend auf den Richtlinien, die von den Organisator*innen der Awareness-Gruppe bei der Anti-G20-Mobilisierung 2009 in Pittsburgh entwickelt wurden, gaben die Organisator*innen bei den Anti-IMF-Mobilisierungen 2010 in Washington DC eine Ankündigung heraus, in der es hieß: »Täter nicht willkommen« . In der Ankündigung wurde erklärt, dass die Demos sicher für Betroffene sein sollten und »Leute, die in der Vergangenheit übergriffig waren, Leute, die sich einem Verantwortungsprozess verweigern, und Leute, die sich weigern die ›IMF Resistance Network‹-Konsensrichtlinien zu respektieren« von allen Organisationsstrukturen und Veranstaltungen ausgeschlossen seien. Diese Ankündigung hallte in den Worten der Organisator*innen der Toronto Anarchist Book Fair wider, die ebenfalls allen Täter*innen ein Hausverbot aussprachen und hinzufügten:
»Wir verstehen und respektieren, dass Communitys ihre eigenen Prozesse bei solchen Vorfällen durchlaufen. Wenn du einen Aufarbeitungsprozess durchlaufen hast und die Betroffene, unterstützt durch die Community, das Gefühl hat, dass du dich zufriedenstellend mit deinem Scheiß auseinandergesetzt hast, gilt dieses Statement nicht für dich.«
Ein ähnliches Statement wurde von den Organisator*innen der New York Anarchist Book Fair 2012 veröffentlicht, nach welchem folgende Menschen ausgeschlossen sind:
»Menschen, die zwischenmenschliche Gewalt, Übergriffe und/oder Belästigungen begangen haben, es sei denn, sie sind aktiv an einem Prozess der Community Accountability beteiligt und erfüllen derzeit alle Bedingungen und/oder Forderungen dieses Prozesses (laut den Moderator*innen, der Betroffenen und/oder denjenigen, die dazu bestimmt wurden, die aus dem Prozess hervorgehenden Vereinbarungen zu überwachen).«
Ein Hauptgrund für Kontroversen war der präventive Ausschluss von Individuen, denen sexualisierte Gewalt vorgeworfen wurde, von anarchistischen Treffen. In den vergangenen Jahren wurde von Betroffenen und ihren Unterstützer*innen zunehmend gefordert, bestimmte Individuen mit Tätervorwürfen von bevorstehenden Veranstaltungen auszuschließen. Organisator*innen kämpften damit, dem Glauben der Aussagen der Überlebenden Priorität zu schenken, ohne Menschen präventiv zu verurteilen, und ein Gleichgewicht zwischen Transparenz und Privatsphäre herzustellen sowie eine Retraumatisierung zu vermeiden. Ein digitaler Tumult entstand, als eine Person eine E-Mail online stellte, die sie von den Organisator*innen der New Yorker Anarchistischen Buchmesse erhalten hatte, in der sie gebeten wurde, nicht teilzunehmen, ohne aber den Grund dafür anzugeben. Einige interpretierten die E-Mail als eine kafkaeske, autoritäre Schuldzuweisung durch anonyme Gerüchte, während andere sie als Versuch verteidigten, neutral zu bleiben und gleichzeitig zu versuchen, anderen Teilnehmer*innen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.
Während über unsere Methoden zum Umgang mit Übergriffen weiterhin kontrovers diskutiert wird, haben sich die Normen in Bezug auf Sexualität in den letzten Jahren innerhalb der anarchistischen Szenen deutlich verschoben. Die Diskurse über Konsens haben sich ausgeweitet, während Informationen über Übergriffe, Unterstützer*innen-Angebote und Optionen der Verantwortungsübernahme zunehmend verfügbar geworden sind. Dies hat die Art und Weise, wie wir sexuelle Beziehungen führen, uns auf unseren eigenen Körper beziehen und auf Betroffene reagieren, merklich verändert. Im Vergleich zu früheren Jahren sind sich viele Anarchist*innen der sexuellen Machtdynamiken bewusster geworden und haben zunehmend die Fähigkeit erlangt, Grenzen und Wünsche zu vermitteln.
Wie dem auch sei – manchmal sprechen Täter innerhalb anarchistischer Communitys ›die neue Sprache‹ von Konsens und Support, während sie genau die gleiche alte Scheiße machen.
Wie die Autorin von »Is the Anarchist Man Our Comrade?« es formuliert:
»Accountability Prozesse erreichen oft viel Gutes, manchmal bringen sie jedoch Männern lediglich bei, wie sie nicht-übergriffig wirken, ohne dass sich etwas bei ihnen ändert, außer den Worten, die sie benutzen. Betroffene und Freund*innen fragen sich dann, ob der besagte Mann weiterhin eine Bedrohung ist. Schließlich gerät das Thema in den Köpfen der Menschen in den Hintergrund, weil sie nicht übermäßig rückwärtsgewandt erscheinen wollen und auch nicht wissen, welche weiteren Schritte sie überhaupt unternehmen könnten, und der Täter ist in der Lage, sein Leben ohne große Veränderungen weiterzuleben.«
Wie können wir verhindern, dass diese Diskurse vom sensiblen anarchafeministischen Täter übernommen werden? Es scheint so, als habe die verstärkte Anwendung von Community Accountability Prozessen die Verhaltensmuster, für die sie entwickelt wurden, nicht verändert. Was funktioniert hier nicht?
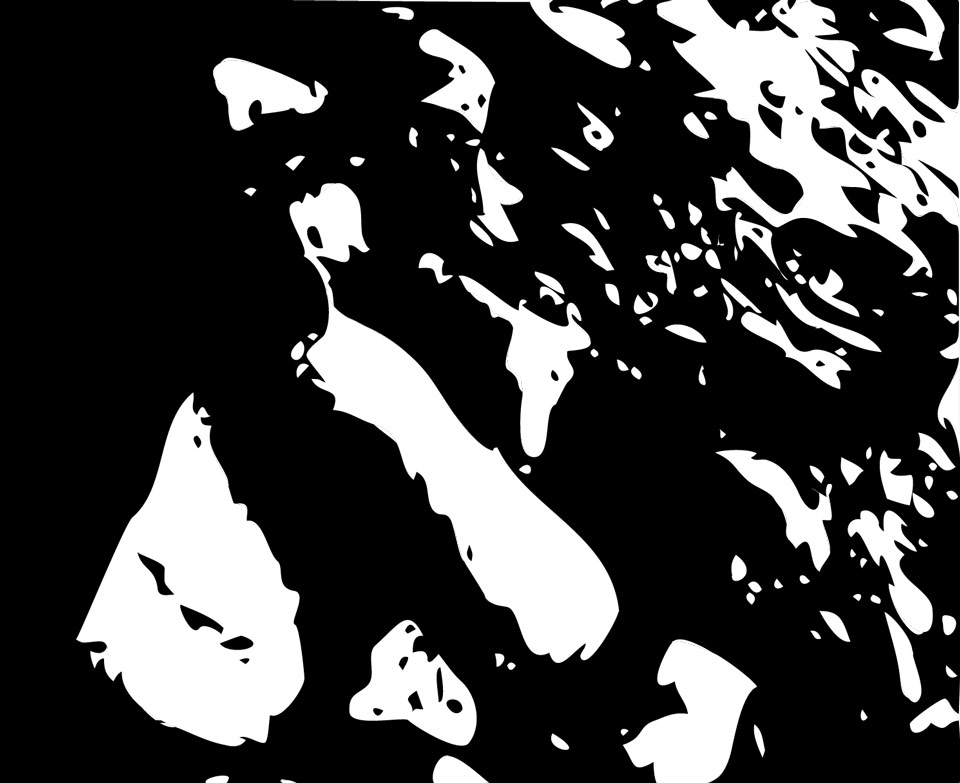
Zehn Schwierigkeiten von Community Accountability Prozessen
Zwei wichtige Einschränkungen: Erstens sind dies Schwierigkeiten von Prozessen, in der Form, wie sie tatsächlich praktiziert werden und wie wir sie erlebt haben. Einige dieser Schwierigkeiten sind nicht den Prozessen inhärent, sie sind einfach wiederkehrende Fehler der Leute, die sich in solchen Prozessen engagieren. Mensch könnte dieser Kritik also entgegenhalten: »Nun gut, wenn die Leute das Modell aber so, wie es gedacht ist, anwenden würden, würde das nicht passieren.«
Das ist in Ordnung, aber damit ein solches Modell auf breiter Ebene relevant und anwendbar ist, muss es robust genug sein, um auch dann erfolgreich zu sein, wenn die Bedingungen nicht optimal sind oder wenn die Menschen dem Modell nicht perfekt folgen können oder wollen. Behaltet aber im Hinterkopf, dass diese Schwierigkeiten nicht bedeuten, dass unsere Modelle aussichtslos oder komplett ungeeignet sind. Eben wenn es uns darum geht, wie wir Übergriffe beenden können, müssen wir unsere Bemühungen unerschrocken überprüfen und kritisieren.
Zweitens sollten die Dinge, die Menschen häufig sagen, um sich der Verantwortung zu entziehen, nicht mit Problemen der Prozesse an sich verwechselt werden. Zum Beispiel: »Dieses Zeug lenkt uns von den wirklichen, revolutionären Themen ab; es ist spaltend und schadet der Bewegung; Menschen zur Verantwortungsübernahme zu drängen ist manipulativ/zwanghaft/überbetont/eine Machtergreifung«, und so weiter. Das sind keine Probleme der Community Accountability, das sind Probleme des Patriarchats und seiner selbsternannten anarchistischen Apologeten!
Abgesehen davon, findet ihr nachfolgend einige der größten Schwierigkeiten, auf die wir bei den Prozessen, die entwickelt wurden, um Verantwortung für sexualisierte Übergriffe in anarchistischen Szenen zu übernehmen, gestoßen sind.
1) Es gibt keine klare Definition davon, wann es vorbei ist und was Erfolg oder Misserfolg ausmacht. Wann können wir definitiv behaupten, dass jemand »sich mit seinem Scheiß auseinandergesetzt« hat? Was ermöglicht es einer Betroffenen und ihren Unterstützer*innen, sich mit einer Person wieder wohl zu fühlen, wenn diese in der gemeinsamen Community bleibt? Wenn die Erwartungen nicht explizit benannt werden, die Ziele nicht konkret sind oder der Zeitplan und die Kriterien zur Bewertung nicht klar sind, können Verwirrung und Frustration bei allen Beteiligten entstehen.
Dies geschieht oft, weil wir so wenig Erfahrung mit alternativen Formen der Konfliktlösung und Bewältigung von Verletzungen haben, dass wir nicht wissen, wonach wir suchen sollen. Selbst wenn eine Person beispielsweise ›Verantwortung übernommen‹ hat, muss das nicht bedeuten, dass sich die Betroffene besser fühlt. Bestimmt dies den Erfolg oder Misserfolg eines Prozesses? Wenn einer all die Dinge getan hat, die von ihm verlangt wurden, aber andere sich nicht sicher sind, ob die unternommenen Schritte wirksam waren, was könnte bestätigen, dass ein wirklicher Wandel stattgefunden hat? Es kann sein, dass es tatsächlich möglich ist, das Vertrauen wiederherzustellen, nachdem Verletzungen verursacht wurden; wenn das nicht der Fall ist, ist dies vielleicht nicht die richtige Art von Prozess für die Situation.
Ab welchem Punkt können wir uns darauf einigen, dass sich einer NICHT mehr mit seiner Scheiße auseinandersetzt, und wir uns nicht mehr die Mühe machen und unsere Zeit damit verschwenden sollten? Einige Prozesse ziehen sich über Monate und Jahre hin und lenken die kollektive Energie von anderen erfüllenderen und nützlicheren Zielen ab. Ein hartnäckiger Sexist kann eine ganze Szene verbittern lassen, indem er den guten Glauben an seinen Willen zur Veränderung in Bezug auf die Übernahme von Verantwortung ausnutzt – was zeigt, wie wichtig es ist, zu wissen, wann man einen angefangenen Prozess beenden muss, bevor er alle mit runterzieht. Wenn wir so viel Zeit und Energie in diese Prozesse investieren wollen, brauchen wir einen Weg, um zu beurteilen, ob es sich lohnt und ab wann wir ein Scheitern eingestehen müssen. Und dazu muss bestimmt werden, was ein Scheitern bedeuten würde: zum Beispiel den Täter aus einer Szene rauszuwerfen, andere Reaktionsweisen auszuprobieren oder einer Betroffenen gegenüber zuzugeben, dass wir ihre Forderungen nicht durchsetzen können.
2) Standards für einen erfolgreichen Prozess festzulegen, ist unrealistisch. Zum Beispiel ist die gängige Forderung, dass er an seiner sprichwörtlichen Scheiße arbeitet, entweder zu vage, um sinnvoll zu sein, oder müsste praktisch zu einer tiefgreifenden psychologischen Veränderung führen, die die Grenzen dessen, was wir erreichen können, sprengt. Der Artikel »Thinking Through Perpetrator Accountability« (Verantwortungsübernahme bei Tätern überdenken) beschreibt es so:
»Verantwortungsübernahme seitens des Täters ist kein einfacher oder kurzer Prozess… Es bedarf eines lebenslangen Engagements, um Verhaltensweisen zu ändern, die so tief verwurzelt sind; es erfordert kontinuierliche Anstrengungen und Unterstützung. Wenn wir über Folgemaßnahmen sprechen, sollten wir einen Zeitplan für Wochen erstellen, aber auch über Überprüfungen nach Monaten und Jahren sprechen. Es braucht diese Art von langfristiger Unterstützung, um eine echte Transformation zu ermöglichen.«
Seien wir ehrlich: Wenn wir erwarten, dass Menschen in einem Prozess der Community Accountability für irgendeinen Dreckskerl, den sie nicht einmal mögen, jahrelang involviert bleiben, und wir dies als Norm setzen für eine zunehmende Anzahl von Prozessen für verschiedene Menschen, die vielleicht oder vielleicht auch nicht kooperativ sind – dann setzen wir keinen realistischen Standard.
Damit wollen wir nicht sagen, dass der Ansatz falsch ist; die Veränderung von patriarchalen und gewalttätigen Verhaltensmustern ist ein lebenslanger Prozess.
Aber ist es wirklich eine Überraschung, dass es uns nicht gelingt, diese schwierigen, undankbaren Prozesse, die sich über so lange Zeiträume erstrecken, durchzuziehen? Insbesondere, wenn wir bedenken, dass nur wenige Anarchist*innen in unserer Szene langfristige Verpflichtungen selbst für unsere inbrünstigsten Leidenschaften eingehen? Wozu können wir uns, realistisch gesehen, wirklich verpflichten?
3) Uns fehlt die kollektive Fähigkeit, viele Forderungen zu realisieren. Wir können behaupten, dass wir den Forderungen der Betroffenen nachkommen wollen, aber das ist nur leere Rhetorik, wenn das Ressourcen erfordert, die wir nicht haben. Kennen wir geeignete antiautoritäre feministische Berater*innen und Therapieprogramme, und können wir sie bezahlen, wenn die beschuldigte Person das nicht kann? Können wir unsere Anliegen gegenüber jemandem durchsetzen, der nicht kooperativ ist – und sollten wir das als Anarchist*innen tun? Welche Konsequenzen können wir durchsetzen, die tatsächlich von Bedeutung sind? Können wir uns innerhalb einer kurzlebigen Subkultur realistischerweise dazu verpflichten, ihn über Jahre zu begleiten und Strukturen der Unterstützung und Community Accountability schaffen, die so lange bestehen bleiben?
Ein regelmäßig verwendetes Schlagwort, das in den Forderungen der Betroffenen und im Unterstützungsdiskurs häufig verwendet wird, ist der ›sichere Raum‹ / ›Schutzraum‹, jener immer wieder schwer definierbare Ort, an dem sich die Betroffenen wohl fühlen und vollständig in das kollektive Leben integriert werden können. Was bedeutet Sicherheit oder Schutz? Ist das etwas, das wir versprechen können? Wenn man die Politik bei anarchistischen Versammlungen in jüngster Zeit anschaut, scheint es, dass die primäre Methode zur Sicherung des sicheren Raums darin besteht, Menschen auszuschließen, die anderen geschadet haben. Aber Sicherheit bedeutet mehr als die Quarantäne derer, die es für bestimmte Leute unsicher gemacht haben. Rape Culture und das Patriarchat durchziehen unser ganzes Leben – und sind nicht nur das Resultat des Verhaltens einiger Einzeltäter. Während Ausgrenzung Betroffene vor dem Stress, den Raum mit Menschen zu teilen, die ihnen geschadet haben, schützt und dazu beitragen kann, die Menschen in unserer Gemeinschaft vor wiederholt übergriffig handelnden Personen zu schützen, beinhaltet Ausgrenzung schmerzhafterweise dennoch nicht Sicherheit. In der Tat können wir darauf bauen, andere aus Räumen zu verbannen, weniger weil es die Sicherheit der Menschen gewährleistet, sondern weil es eine der wenigen sicherheitsrelevanten Forderungen ist, die wir tatsächlich durchsetzen können.
In dem Essay »Safety is an Illusion« verurteilt Angustia Celeste die »falschen Versprechungen von sicheren Räumen«:
»Wir können Betroffenen keinen sicheren Raum bieten; ein sicherer Raum im allgemeinen Sinne, außerhalb von engen Freundschaften – und manchmal noch von Familie und gelegentlich innerhalb von Beziehungen, existiert einfach nicht… Es gibt keinen sicheren Raum im Patriarchat oder im Kapitalismus angesichts all der sexistischen, heteronormativen, rassistischen, klassistischen (usw.) Herrschaft, unter der wir leben. Je mehr wir es versuchen und so tun, als gäbe es Sicherheit auf Gemeinschaftsebene, desto enttäuschter und verratener werden unsere Freunde und Liebhaberinnen sein, wenn sie Gewalt erleben und keine Unterstützung erhalten.«
Wie würde echte Sicherheit für Betroffene und für uns Alle aussehen? Gibt es andere Strategien in dieser Richtung, die wir jenseits von Ausgrenzung und Ächtung verfolgen können?3
4) Es fehlt uns an Fähigkeiten in der Beratung, Mediation und Konfliktlösung. Eine häufige Forderung ist die nach Beratung oder Vermittlung. Um effektiv zu sein, sollte diese Person bereit sein, kostenlos oder für geringe Kosten zu arbeiten; eine antiautoritäre Politik und eine feministische Analyse vertreten; die Zeit und Energie haben, eine aktive Rolle in der Arbeit mit einer gewaltausübenden Person über einen langen Zeitraum zu übernehmen; und nahe genug an der Gemeinschaft sein, um ihre Normen zu verstehen, ohne direkt in die Situation involviert zu sein. Wie viele Personen gibt es, die diese Voraussetzungen erfüllen? Wie viele von uns haben überhaupt grundlegende Fähigkeiten des aktiven Zuhörens, ganz zu schweigen von der Fähigkeit, sich durch komplexe Dynamiken von Konsens und Übergriff, patriarchale Konditionierung, antiautoritäre Konfliktlösung und psychologische Transformation zu navigieren? Und von den wenigen, die den Anforderungen entsprechen oder zumindest nahe dran sind: wie viele sind nicht bereits massiv eingebunden und überfordert?
Vielleicht ist es die Schuld aller, dass diese Fähigkeiten nicht kollektiv priorisiert werden. Schön und gut, aber was machen wir jetzt? Und wie vermeiden wir es, eine Arbeitsteilung zu schaffen, bei der Leute mit bestimmten Fähigkeiten und Fachwissen in anarchistischen Versionen von Gerichtsprozessen zu Autoritäten werden?
5) Diese Sachen deprimieren Leute und führen zu Burn Out. Es ist eine intensive, emotional anstrengende Arbeit, sich in Community Accountability Prozessen einzusetzen, oft verbunden mit wenig Wertschätzung oder Entschädigung. Es kann anstrengend und undankbar sein, insbesondere da es selten gelingt, eine Gemeinschaft intakt zu halten und gleichzeitig alle Beteiligten zufrieden zu stellen. Die Schwere der Arbeit schreckt Menschen ab, und das ist verständlich.
Das soll nicht heißen, dass wir versuchen sollten, Community Accountability für sexualisierte Gewalt lustig und unbeschwert zu gestalten. Aber wir müssen anerkennen, dass dies ein Hindernis für Menschen ist, sich langfristig zu engagieren – und das wiederum ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Prozesse. Und diese Probleme werden noch verstärkt, wenn wir uns auf Fähigkeiten und Erfahrungen verlassen, über die nur wenige Menschen in unseren Kreisen verfügen.
6) Community-Accountability-Prozesse verschlingen unverhältnismäßig viel Zeit und Energie. Keine*r von uns hat sich für Anarchie entschieden, weil wir gerne an anstrengenden, endlosen Prozessen teilnehmen, in denen wir uns mit den unzähligen Varianten, wie sich Menschen in unseren subkulturellen Blasen gegenseitig verletzen, auseinandersetzen. Wir sind Anarchist*innen geworden, weil wir die Polizei hassen, weil wir Punk-Konzerte lieben, weil wir eine freiere Welt wollen, und aus einer Million anderer Gründe. Wenn wir so viel Zeit und Energie darauf verwenden, interne Konflikte zu lösen und unnachgiebige Sexisten davon zu überzeugen, die Verantwortung für die Änderung ihres Verhaltens zu übernehmen, riskieren wir, unsere Leidenschaften zu verlieren, die uns überhaupt erst zusammengebracht haben.
Es ist leicht, von anarchistischer Politik demoralisiert zu werden, wenn wir nicht einmal aufhören können, uns gegenseitig zu verletzen, ganz zu schweigen von der Zerschlagung des Staates und der Abschaffung des Kapitalismus. Es ist nicht so, dass die Arbeit an der Beendigung sexualisierter Gewalt und des Patriarchats nicht revolutionär ist – im Gegenteil! Aber wenn die Community-Accountability-Prozesse – insbesondere die frustrierenden und erfolglosen – zu viel von unserer kollektiven Energie in Anspruch nehmen, werden wir wahrscheinlich nicht engagiert bleiben und auch keine neuen Leute in unsere Kämpfe einbinden.
Wir können Übergriffe nicht unter den Teppich kehren und die Betroffenen im Namen der falschen Einheit zum Schweigen bringen. Diese früher vertretene Norm verewigte die Unterdrückung und machte uns rundum weniger effektiv, was erst dazu führte, dass Community Accountability überhaupt in Gang kam. Wir müssen einen Weg finden, mit unserem übergriffigen Verhalten umzugehen, der nicht unsere ganze Energie verschlingt und uns nicht demoralisiert.
7) Subkulturelle Bindungen sind so schwach, dass Menschen einfach aussteigen. Wir sollten daran denken, dass viele antiautoritären Modelle der Wiederherstellenden Gerechtigkeit, die die Rahmenbedingungen der Community Accountability darstellen, ihren Ursprung in kleineren indigenen Gesellschaften haben, die stärkere soziale und kulturelle Affinitäten haben, als sich die meisten von uns in den heutigen Vereinigten Staaten vorstellen können. Der Gedanke, dass wir versuchen sollten, die Gemeinschaft zu erhalten und Menschen, die andere verletzt haben, in sie integriert zu lassen, beruht auf der Annahme, dass alle Parteien genug in diese ›Gemeinschaft‹ investiert haben, um die Prüfung und die schwierigen Gefühle zu ertragen, die mit dem Durchlaufen eines solchen Prozesses einhergehen. Die Affinitäten, die Menschen an Punk- und Anarchoszenen binden, sind oft nicht stark genug, um die Menschen zu binden, wenn sie sich von dem, was von ihnen verlangt wird, bedroht fühlen. Leute, denen etwas vorgeworfen wird, nehmen oft einfach ihre Sachen und verlassen die Stadt, manchmal sogar präventiv, bevor sie sich für ihr beschissenes Verhalten verantworten müssen. Wenn wir nicht mit ähnlichen sozialen Netzwerken am neuen Wohnort des Täters kommunizieren können (was immer häufiger geschieht), können wir nicht viel tun, um dies zu verhindern. Wenn die primären Konsequenzen, die wir für die Nichtübernahme von Verantwortung fordern können, Formen der Ächtung und Ausgrenzung sind, werden die Menschen diese vermeiden oder umgehen, indem sie die Stadt oder die Szene verlassen.4
8) Kollektive Normen ermutigen und entschuldigen unverantwortliches Verhalten. Unsere individuellen Entscheidungen finden immer in einem sozialen Kontext statt, und einige der kollektiven Normen anarchistischer Szenen erleichtern und rechtfertigen Verhaltensweisen, die oft zu Grenzüberschreitungen und Vorwürfen geführt haben.
Beispielsweise herrscht in vielen anarchistischen Szenen eine Kultur des Rausches vor, und die meisten gesellschaftlichen Zusammenkünfte drehen sich um Alkohol- und Drogenkonsum. Es gibt nur wenige Schutzvorkehrungen, wenn die Menschen zu viel trinken oder konsumieren, und es gibt nur wenige alternative Räume für diejenigen, die mit dem Trinken oder Konsumieren aufhören oder es reduzieren wollen, ohne ihr soziales Leben zu verlieren. Humor und Gesprächsnormen verstärken die Vorstellung, dass extreme Trunkenheit normal und lustig ist und dass Menschen in betrunkenem Zustand weniger verantwortlich für ihre Handlungen sind als in nüchternem Zustand. Wochenende für Wochenende schaffen wir hochgradig sexualisierte Räume mit starkem Druck, sich zu berauschen, was dazu führt, dass Gruppen von Menschen zu betrunken oder high sind, um eine solide Zustimmung zu geben oder zu erhalten.5
Dann erwarten wir, dass der Einzelne, nachdem in solchen Situationen Verletzungen verursacht wurden, mit den Folgen seiner Entscheidungen allein fertig wird, anstatt dass wir alle die Verantwortung für den kollektiven Kontext übernehmen, der sein Verhalten normalisiert.
Selbstverständlich entschuldigt keine dieser Dynamiken sexualisierte Gewalt. Aber sexualisierte Übergriffe finden in einem sozialen Kontext statt, und Gemeinschaften können Verantwortung für die Art von Verhalten, das durch unsere sozialen Normen gefördert wird, übernehmen oder vermeiden. Alkohol- und Drogenkonsum sind nur ein Beispiel für eine Gruppennorm, die unverantwortliches Verhalten entschuldigt. Andere fest verwurzelte Dynamiken, die von Leuten, die Verantwortung übernehmen wollen, als hinderlich für ihre Bemühungen angeführt werden, sind die ›Vergötterung‹ von ›Prominenten‹ innerhalb der Szene (Leute in populären Bands, renommierte Aktivist*innen usw.); die Vorstellung, dass sexuelle und romantische Beziehungen ›privat‹ sind und nicht die Angelegenheit einer außerhalb befindlichen Instanz; und der Glaube, dass Gruppen, die systematischer Unterdrückung ausgesetzt sind (wie Queers und PoC), nicht die ›schmutzige Wäsche‹ innergemeinschaftlicher Gewalt ›lüften‹ sollten, da dies dazu benutzt werden könnte, sie weiter zu dämonisieren.
Sind wir bereit, unsere Gruppennormen auf kollektiver Ebene zu überprüfen und infrage zu stellen, um zu sehen, wie sie verantwortliches Verhalten fördern oder entmutigen? Ist es möglich, ganze Szenen kollektiv für das, was wir dulden oder entschuldigen, zur Verantwortung zu ziehen? Der Versuch, eine ganze Gruppe von Menschen in irgendeiner strukturierten Weise zur Verantwortung zu ziehen, würde wahrscheinlich alle Probleme vervielfachen, die wir bei Community-Accountability-Prozessen haben, die sich an einer einzigen Person orientieren. Doch ohne unsere kollektive Verantwortung anzuerkennen und infrage zu stellen, wird es nicht ausreichen, den Einzelnen zur Verantwortung zu ziehen.
9) Die internalisierten Überbleibsel des strafrechtlichen Justizsystems beeinträchtigen unsere Anwendung von Modellen der Community Accountability. Einige der heftigsten Gegenreaktionen gegen Community-Accountability-Prozesse sind auf deren pseudo-juristische Natur zurückzuführen.
Einerseits haben Menschen, die Gewalt ausgeübt haben, nur selten die Erfahrung gemacht, dass sie für ihr Verhalten anders zur Rechenschaft gezogen werden als über autoritäre Systeme; Versuche, dies zu tun, führen oft zu Vorwürfen der ›Hexenjagd‹, des ›Autoritarismus‹ und von Vergleichen mit Polizisten/Richterinnen/Anwälten/Gefängniswärterinnen. Frühere militante Gegner des Staates vollzogen so oft wundersame Wendungen und interessierten sich plötzlich sehr für die Garantien der US-Regierung in Bezug auf ›Gerechtigkeit‹: »Was ist daraus geworden, dass einer unschuldig ist, bis die Schuld bewiesen ist? Bekomme ich keinen fairen Prozess? Kann ich mich nicht verteidigen? Hört auf meine Entlastungszeugen!«
Auf der anderen Seite sind Leute, die Verantwortung einfordern, ähnlich auf strafrechtliche Konfliktlösung konditioniert, sodass es sehr leicht passieren kann, dass der Prozess entsprechend geframed wird – besonders, wenn sie mit einem wütend machenden, hartnäckigen Anarcho-Vergewaltiger konfrontiert sind. Einige Teilnehmende haben Community-Accountability-Prozesse als eine Möglichkeit genutzt, um anderen mit Konsequenzen zu drohen oder Macht über andere zu erlangen. Dies mag zwar eine verständliche Reaktion auf Frustration und Ohnmacht sein, die oft nach sexualisierter Gewalt empfunden werden, dennoch kann es Versuche untergraben, nichtstaatliche Lösungen zu finden.
Eine vernichtende Kritik am Versagen anarchistischer Prozesse der Verantwortungsübernahme, insbesondere daran, der Logik des Rechtssystems zu entkommen, findet sich in einem Kommuniqué, in dem erklärt wird, warum eine Gruppe von Frauen physisch einen Täter konfrontierte:
»Wir taten, was notwendig war. Als Radikale wissen wir, dass das Rechtssystem auf Scheiße aufgebaut ist – viele Gesetze und Rechtsverfahren sind rassistisch, klassistisch, heterosexistisch und frauenfeindlich. Alternative Prozesse der Verantwortungsübernahme zwingen, ähnlich wie die traditionellen, die Betroffene oft dazu, das Trauma des Angriffs noch einmal zu durchleben, und zwingen sie, ihren Ruf – ein problematisches Konzept an sich – als ›Beweis‹ für ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel zu setzen. Im Endeffekt sind sie ein unwirksamer Nachbau des Gerichtsverfahrens, das den Täter vom Haken lässt, während die Betroffene die Erinnerung an den Überfall für den Rest ihres Lebens durchleben muss. Das US-Rechtssystem und die alternativen Community-Accountability-Prozesse sind für die Betroffenen einfach nicht gut genug und schon gar nicht revolutionär.«
10) Die Sprache und Methoden der Prozesse bei sexualisierten Übergriffen werden in Situationen verwendet, für die sie nicht vorgesehen sind. Ein Beispiel für diese falsche Anwendung ist die weit verbreitete Anwendung des Prinzips der Unterstützung von Überlebenden von Vergewaltigungen, das besagt, dass die Unterstützer*innen ›immer der Überlebenden glauben sollten‹. Dies ist während der Organisation eines Krisenumganges mit einer Vergewaltigung vollkommen sinnvoll – dort wird sich ausschließlich darauf konzentriert, einer Person, die eine Form von Trauma erlebt hat (welches oftmals bestritten wird), emotionale Unterstützung und Hilfe anzubieten; und ein elementarer Teil des Heilungsprozesses ist es, Glauben geschenkt zu bekommen. Aber das macht als Grundlage für Konfliktlösungen keinen Sinn. In der Vergewaltigungskrisenberatung oder wenn sich eine*r an dich als vertraute*n Freund*in wendet, der*die Unterstützung sucht, sollte der Schwerpunkt auf den Bedürfnissen der Überlebenden liegen. Aber zu transformativer Gerechtigkeit gehört es, die Bedürfnisse und damit die Erfahrungen und Perspektiven aller Beteiligten zu berücksichtigen, auch die des Angreifers.
Das bedeutet nicht, dass wir herausfinden müssen, wer die Wahrheit sagt und wer lügt, das ist nur ein weiteres Überbleibsel der Strafjustiz. Das bedeutet auch nicht, dass alle Perspektiven gleich viel zählen und keine*r falsch- oder richtig liegt. Es bedeutet allerdings, dass wir, wenn wir eine Person dazu bringen wollen, Verantwortung zu übernehmen, wir sie dort abholen müssen, wo sie steht, und das bedeutet zu akzeptieren, dass die Erfahrungen einer Person signifikant von denen einer anderen abweichen können. Verantwortung zu übernehmen, erfordert, sich selbst eingestehen zu können, dass mensch falsch lag, oder zumindest, dass eine andere Person die gleiche Situation komplett anders und verletzend wahrgenommen hat. Die Definitionshoheit über die Realität komplette der Betroffenen zu überlassen, führt eventuell nicht zu diesem Modus der Community Accountability.
Ein weiteres Beispiel für die Überstrapazierung und Fehlanwendung des Diskurses zum Umgang mit sexualisierter Gewalt ist die Übertragung. Diese entsteht, wenn eine Person eine andere dazu auffordert, für ein weites Spektrum an Verhaltensweisen (die keine sexualisierten Übergriffe sind) die Verantwortung zu übernehmen und an den entsprechenden Prozessen teilzunehmen. Wenn sich eine*r nach der Trennung einer einvernehmlichen Beziehung verletzt und wütend fühlt, kann es zum Beispiel verlockend sein, seine*ihre Kränkung durch die Linse von Vorwürfen zu sehen und das Gegenüber entsprechend zur Verantwortungsübernahme aufzufordern. Das könnte so weit gehen, dass gefordert wird, eine Person aus bestimmten Räumen zu entfernen, und dass dem Nachdruck verliehen wird durch die Ernsthaftigkeit, die durch die Einbindung solcher Forderungen in Community-Accountability-Prozesse entsteht. Es ist verständlich, dass Leute, die sich aus verschiedenen Gründen wütend oder verletzt fühlen, die Art von sofortiger Bestätigung ihrer Gefühle wollen, die (in manchen Kreisen) dadurch entstehen kann, dass mensch seine Verletzung und Wut als eine Aufforderung zur ›Verantwortungsübernahme‹ darstellt – ob dieser Prozess und diese Sprache für die Situation angemessen ist oder nicht.6
Dies ist nicht nur deshalb gefährlich, weil diese Begriffe und Taktiken für bestimmte Arten von Konflikten konzipiert wurden und nicht für andere, sondern auch, weil ihr übermäßiger Gebrauch sie trivialisieren und andere dazu veranlassen kann, auf die sehr ernsten Situationen, für die sie entwickelt wurden, ablehnend zu reagieren. Es ist ermutigend, dass Themen wie sexualisierte Übergriffe so weit in den Diskurs radikaler Communitys Einzug gefunden haben. Aber wir sollten es vermeiden, die Methoden, die für die Reaktion auf ein bestimmtes Setting von Konflikten und unterdrückenden Verhaltensweisen entwickelt wurden, auf andere Situationen, für die sie nicht vorgesehen waren, zu übertragen.
In einigen Fällen haben Leute, die über das problematische Verhalten einer Person frustriert sind, sogar gezögert, die Person darauf hinzuweisen, aus Angst davor, dass diese Person als ›Täter‹ bezeichnet wird oder dass andere die verletzende, aber milde Form des nicht einvernehmlichen Verhaltens für einen sexualisierten Übergriff halten und somit die Person, die sich an sie wendet, als ›Überlebende*n‹ ansehen. Wenn der übermäßige Gebrauch der Sprache der Verantwortungsübernahme bei sexualisierten Übergriffen mit der Identitätspolitik rund um Überlebende/Täter und einer ›Keine Täter erlaubt‹-Politik einhergeht, könnte dieses Bemühen, die Verantwortungsübernahme zu fördern, dazu führen, dass Menschen davon abgehalten werden, sich gegen andere Formen miesen Verhaltens auszusprechen. Aus Angst, dass einer permanent mit dem ›Täter‹-Stempel markiert wird könnten Situationen eher unausgesprochen bleiben – statt mit der Person ein paar Gespräche zu führen, eine Entschuldigung einzufordern und einige Texte zum Lesen zu geben.

Neue Richtungen und weitere Fragen
Wie geht es also weiter von hier aus? Die weit verbreitete Desillusionierung über Verantwortlichkeitsprozesse deutet darauf hin, dass wir in eine Sackgasse geraten sind. Wir schlagen vier mögliche Wege vor – nicht als Auswege aus der Sackgasse, sondern als Vorschläge zum Experimentieren, um zu sehen, ob sie zu etwas Neuem führen können.
Richtung 1: Vigilantismus der Überlebenden
»Ich wollte Rache. Ich wollte, dass er sich genauso wehrlos, verängstigt und verletzlich fühlt wie er mich hat fühlen lassen. Es gibt keine Sicherheit nach sexualisierten Übergriffen, aber es kann Konsequenzen geben.« - Angustia Celeste, »Safety is an Illusion: Reflections on Accountability«
2010 schlugen zwei Situationen in anarchistischen Kreisen Wellen, bei denen prominente anarchistische Männer von je einer Gruppe Frauen gestellt und attackiert wurden. In den daraus entstandenen Debatten spiegelte sich eine weit verbreitete Frustration über die existierenden Methoden zum Umgang mit sexualisierten Übergriffen innerhalb anarchistischer Szenen wider. Physische Konfrontation ist keine neue Strategie; sie war eine der Arten, mit der Betroffene auf die Täter reagiert haben, bevor der Community-Accountability-Diskurs sich in anarchistischen Zirkeln verbreitete. Nachdem sich Prozesse der Verantwortungsübernahme etablierten, wurde physische Konfrontation von vielen abgelehnt, schließlich hatte sie auch nicht dazu geführt, dass Vergewaltigungen aufhörten oder Leute sicher waren. Der Trend der Rache durch Überlebende, begleitet durch entsprechende Kommuniqués, in denen Prozesse der Verantwortungsübernahme kritisiert wurden, reflektiert die Machtlosigkeit und Verzweiflung von Betroffenen auf der Suche nach Alternativen im Angesicht der Sinnlosigkeit der anderen verfügbaren Optionen.
Wie auch immer – Vigilantismus durch Überlebende kann eine berechtigte Antwort auf sexualisierte Übergriffe darstellen, unabhängig von der Existenz von Alternativen. Mensch muss sich nicht machtlos fühlen oder spüren, dass die anderen Optionen sinnlos sind, um zur entschlossenen physischen Aktion gegen den Täter zu schreiten. Dieser Ansatz hat einige Vorteile. Zum einen setzt er – im starken Gegensatz zu vielen Prozessen der Verantwortungsübernahme – realistische Ziele und kann diese erfolgreich erfüllen. Er kann ermächtigender und erfüllender sein als ein langer, oftmals triggernder und abstrakter Prozess. Frauen können die Konfrontationen nutzen, um gemeinsame Stärke zu entwickeln und so auch gemeinsam weitere Aktionen gegen das Patriarchat durchführen. Die physische Konfrontation sendet die eindeutige Message, dass sexualisierte Übergriffe nicht akzeptabel sind. Wenn sexualisierte Gewalt das Patriarchat auf die Körper der Frauen einbrennt, dann stellt die Rache den weiblichen Widerstand dar. Vor allem ist dieser Ansatz unvermittelt; so wie in dem Artikel »Notes on Survivor Autonomy and Violence« geschrieben:
»Eine häufige Kritik an Verantwortlichkeitsprozessen aller Art ist ihre Tendenz, eine Art gerichtlich strukturierte Vermittlung zur Rehabilitation oder Bestrafung (auf die ein oder andere Art) widerzuspiegeln. Obwohl ein von der Betroffenen diktiertes Ergebnis sicherlich nicht mit einem vom Staat diktierten Ergebnis vergleichbar ist, bleibt der Prozess eine Vermittlung. Umgekehrt bedeutet eine Abkehr von dieser Justiz die Ablehnung der Mediation, ein Überbleibsel der Idee, dass unsere Interaktionen irgendwie von Dritten geleitet werden müssten, sogar von Dritten, die wir selbst wählen. Zu diesem Zweck ist ein Angriff auf den Vergewaltiger unvermittelt und direkt; genau das, was jedes Justizsystem verbietet; die Grenze zwischen Wunsch und Handlung wird aufgehoben.«
Selbstverständlich birgt der Vigilantismus aber auch viele Nachteile. Die Wahl, die Situation zu eskalieren, birgt einige Risiken – sowohl legale aus auch physische. Es ist wahrscheinlicher, dass Cops gegen eine Gruppe wegen eines physischem Angriffs ermitteln, als dass sie gegen einen Mann wegen eines ›angeblichen‹ sexualisierten Übergriffs ermitteln. Wie Unterstützer*innen geschlagener Frauen wissen, gibt es bei Gewalt in der Beziehung eine sehr reale Gefahr, dass diese tödlich ausgeht; es werden mehr Frauen von ihren Partnern umgebracht als von irgendeinem anderen Angreifer. Abgesehen von den unmittelbaren Risiken, kann mensch keine soziale Beziehung verprügeln; das Erdrosseln eines individuellen Dreckskerls macht es nicht viel sicherer für irgendwen und trägt nicht sonderlich viel zur Beendigung der systematischen Rape Culture bei, unabhängig davon, wie befriedigend es sich vielleicht für eine sich erholende Betroffene anfühlt. Wie bereits zuvor erwähnt, trug das Bedürfnis, die Wurzeln der Rape Culture auch im Umgang mit individuellen Übergriffen anzugehen, dazu bei, Community-Accountability-Prozesse überhaupt erst zu etablieren.
Es gibt auch eine Form des Vigilantismus, bei der die Perspektive der Betroffenen nicht berücksichtigt wird, eine weitere Form männlicher Gewalt, die weithin von Betroffenen und anarchistischen Frauen als maskuliner Egotrip und nicht als Hilfe zur Gesundwerdung und Sicherheit betrachtet wird. Eine Kritik an diesem Phänomen findet sich in dem Zine »Survivor of Sexual Assault«, das sich an männliche Verbündete von Betroffenen richtet und das Prinzip »No More Violence« diskutiert:
»Wird das Verprügeln eines Vergewaltigers die Vergewaltigung rückgängig machen? Werden seine Schmerzen dafür sorgen, dass die der Überlebenden verschwinden? Muss die Überlebende wieder versuchen, einen weiteren außer Kontrolle geratenen, gewalttätigen Mann zu beruhigen? Vermutlich nicht.
Da cis Männer verantwortlich für die überwältigende Mehrheit (manche sagen über 99%) der sexualisierten Übergriffe sind, müssen Männer, die Überlebende unterstützen, sich besonders bewusst sein über die Auswirkungen männlicher Gewalt. Männliche Gewalt ist die Ursache von Vergewaltigungen und nicht ihr Ende. Ihr Verhalten muss dem Ende männlicher Gewalt dienen. Wir können nicht für Reaktionsweisen von Überlebenden, im speziellen Frauen, plädieren. Wenn Frauen, als Mehrheit der Überlebenden, sich entscheiden, kollektiv auf eine Art zu reagieren, die Gewalt beinhaltet, oder männliche Unterstützer bitten, daran teilzunehmen, dann ist das etwas, was Frauen und Überlebende unter sich ausmachen müssen. Für männliche Unterstützer einer Überlebenden ist es in jedem Fall absolut essenziell, die Begierde nach männlicher Vergeltung zurückzustellen und den Kreis männlicher Gewalt zu durchbrechen… Es ist weder ihre Verantwortung noch ihr Recht im Bürgerwehr-Style aufzutauchen und die Sache in die eigenen Hände zu nehmen.«
Diese Kritik beeinflusste Gruppen wie DWOS aus Minneapolis, ›Gewaltfreiheit‹ als Prinzip zu übernehmen. Zu bedenken ist aber, dass sich diese Kritik bewusst nicht auf Vigilantismus durch Überlebende bezieht, sondern auf unverantwortliche Reaktionen von nicht direkt Betroffenen.
Verteidiger*innen der durch Betroffene angegriffenen Männer behaupten, Vigilantismus sei autoritär: »Verantwortungsübernahme darf keine Einbahnstraße sein, sonst wird sie zu einem Synonym für Straf- und Polizeigewalt.« Aber wie die Kommuniqués der Betroffenen deutlich machen, ist Vigilantismus keine Form der ›Verantwortungsübernahme‹, zumindest nicht die auf transformativer Gerechtigkeit basierende Community Accountability, wie sie in anarchistischen Kreisen im Allgemeinen gedacht wird; es ist eine ausdrückliche Ablehnung davon. Er ist kein pseudo-juristischer Prozess; er verneint sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Methoden der Konfliktlösung zugunsten einer direkten, unmittelbaren Reaktion auf Verletzungen. Ungeachtet der Frage, ob wir das für angemessen halten oder eben nicht, sollten wir es nicht als eine Form von missglücktem Verantwortlichkeitsprozess betrachten. Im Gegenteil: Es ist eine bewusste Reaktion auf das vermeintliche Scheitern von Prozessen der gemeinschaftlichen Verantwortungsübernahme.
Solange unsere Praxis der Verantwortungsübernahme für sexualisierte Gewalt nicht erfolgreich den Bedürfnissen der Menschen entspricht, wird der Vigilantismus weitergehen und anarchistische Verfechter*innen der transformativen Gerechtigkeit herausfordern, ihre Ideale Realität werden zu lassen. Sollten wir versuchen, ausreichend wirksame Prozesse der Verantwortungsübernahme zu entwickeln, sodass Vigilantismus nicht notwendig ist? Oder sollten wir Praktiken der von Überlebenden geführten physischen Konfrontation entwickeln und ausweiten?
Richtung 2: Prävention durch genderbezogene Organisation
Es ist ein offensichtlicher Punkt, aber wichtig darauf hinzuweisen: Statt all diese Energie darauf zu verwenden, herauszufinden, wie wir Betroffene unterstützen und auf jeden, der Gewalt ausübt, reagieren können– wäre es da nicht viel schlauer diesen ganzen Übergriffen von Anfang an vorzubeugen? Na klar, einfacher gesagt, als getan. Aber bislang haben wir nur Reaktionen auf Verletzungen diskutiert – und wir gehen davon aus, dass diese Verletzungen weiter stattfinden werden, selbst wenn wir bessere Wege finden, darauf zu reagieren.
Um die Sprache der gemeinnützigen Frauenhäuser zu übernehmen, fällt die Reaktion auf Übergriffe und die Arbeit mit den Angreifern im Rahmen von Prozessen der Verantwortungsübernahme in den Bereich der Intervention oder tertiären Prävention. Die primäre Prävention umfasst das Verhindern erstmaliger Übergriffe durch Bildung und durch Verschiebung sozialer, kultureller und institutioneller Normen, während die sekundäre Prävention die Identifizierung von Risikofaktoren im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt und das Eingreifen zur Verhinderung ihrer Eskalation umfasst. Deshalb sollten wir Reaktionen wie Verantwortungsübernahmeprozesse nicht unbedingt als gescheitert betrachten, wenn sexualisierte Übergriffe in anarchistischen Gemeinschaften weiter stattfinden. Stattdessen sollten wir die Art der präventiven Arbeit, die wir neben ihnen leisten, ausweiten. Was könnten wir tun, um all dies von vornherein zu verhindern?
Außerhalb anarchistischer Kreise zentriert sich Präventivarbeit zu genderbasierter Gewalt rund um Bildung: für Frauen rund um Selbstverteidigung und Schadensbegrenzung; für Männer rund um die Bekämpfung von Vergewaltigungsmythen und zur Verantwortungsübernahme bei der Beendigung männlicher Gewalt; und für alle rund um gesunde Kommunikations- und Beziehungsfähigkeiten. In anarchistischen Kreisen haben sich einige Frauen zusammengetan, um Selbstverteidigungsfähigkeiten zu teilen, und es gibt viele Bildungsangebote (meistens organisiert und getragen von Frauen) zu Konsens, Kommunikation mit Partner*innen und positiver Sexualität. Wie bereits erwähnt, hat dies zwar den Diskurs über Sexualität von Anarchist*innen verschoben, aber wir brauchen eine umfassendere Auseinandersetzung mit genderbasierter Unterdrückung, um die eingefahrenen Muster zu durchbrechen.
Ein Weg zu dieser tiefergehenden Veränderung führt über genderbasierte Kollektive, insbesondere über Männergruppen, die sich auf eine Veränderung der Einstellung zu Sexualität und Konsens unter Männern fokussieren. Dennoch gibt es, bis auf wenige Ausnahmen wie DWOS in Minneapolis, dem Philly Dudes Collective und dem Social Detox Zine, in den letzten Jahren kaum sichtbare Ansätze anti-sexistischer Organisation unter Männern innerhalb der anarchistischen Szene. Früher verbündeten sich in bestimmten Szenen antisexistische Männergruppen mit autonomen Frauengruppen. Diese Bündnisse sind derzeit aus einer Reihe von Gründen aus der Mode gekommen, darunter antifeministische Backlashs, ein gewisses Verständnis von Trans- und Gender-Queer-Politik, das alle genderbasierenden Organisationen als essenzialistisch und problematisch abstempelt, und die Absorption so vieler engagierter antipatriarchaler Aktivist*innen in die Reaktion auf sexualisierte Übergriffe und in Community Accountability. Könnte die Bildung von antisexistischen Männergruppen zur Prävention von sexualisierter Gewalt in Verbindung mit der autonomen Organisation von Frauen eine weitere Richtung sein, in die mensch experimentieren könnte?
Dieser Ansatz könnte einige Vorteile bieten. Der Aufbau von Strukturen, in denen Skills zur Demontage des Patriarchats und zur Selbstveränderung geteilt werden, könnte problematisches Verhalten der Teilnehmenden reduzieren und gleichzeitig eine Infrastruktur bieten, um gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, sollten Leute andere verletzen. Bereits bestehende Männergruppen bieten die Möglichkeit, dass Männer Verantwortung übernehmen und sich selber weiterbilden und aktiv gegen das Patriarchat werden, ohne dass dies von einem ›Täter‹-Label oder ›Forderungen‹ abhängig ist. Und mensch könnte Männer für eine Vielzahl von Verhaltensweisen, die an sich vielleicht noch wenig problematisch sind, aber Warnzeichen für zugrunde liegende patriarchale Muster sein könnten, an Gruppen verweisen, sodass andere eingreifen können, bevor sich diese Muster auf schädlichere Weise manifestieren (d.h. Sekundärprävention). Endlich hätten wir einen Ort, auf den wir Menschen verweisen können, die, sei es aus Gemeinschaftszwang oder aus Eigenmotivation, »an ihrer Scheiße arbeiten« wollen.
Aber über den bloßen Umgang mit problematischen Verhaltensweisen hinaus bieten Männergruppen Raum für tieferen Beziehungsaufbau, Lernen, politische Aufklärung, emotionale Intimität und sogar Spaß. Dies sollte ein Anreiz für Männer sein, sich zu engagieren und engagiert zu bleiben, da diese Gruppen nicht nur auf eine lähmend intensive Verantwortungsübernahme im Krisenmodus ausgerichtet ist. Die Arten des Studiums, der Reflexion und des Aufbaus von Beziehungen, die in diesen Gruppen stattfinden, können die anderen radikalen Organisationen in anarchistischen Szenen stärken, uns mehr Optionen und Fähigkeiten zur Verfügung stellen, mit denen wir in Krisensituationen reagieren können, und unseren Szenen neue Menschen zuführen. Und im Gegensatz zu vielen intern fokussierten Strategien der Community Accountability können Männergruppen mit nichtanarchistischen Einzelpersonen und Gruppen interagieren, um antipatriarchale Botschaften und Praktiken zu verbreiten und gleichzeitig von anderen feministischen Organisationen zu lernen, sodass unsere Bemühungen für breitere soziale Kämpfe gegen genderbasierte Gewalt und Patriarchat relevant werden.
Aber wartet mal… was ist mit diesem ganzen Gender-Ding? In der gegenwärtigen Gender-Politik in den anarchistischen Szenen Nordamerikas ist es weit verbreitet, jede genderspezifische Organisierung als suspekt zu betrachten. Ist diese nicht nur ein Überbleibsel ermüdender Identitätspolitik, Überrest linker Schuld, überholter Essenzialismus und einer autoritären Praktik verdächtig? Wollen wir nicht die Binarität rund um Geschlecht, die Wurzel des Patriarchats und genderbasierter Unterdrückung zerstören? Und verstärkt das Organisieren auf der Grundlage des Gender (oder des zugewiesenen Genders oder was auch immer) nicht nur den patriarchalen und transphoben Rahmen, den wir zu zerstören versuchen?
Sicherlich sind es schwierige Fragen, wie wir bestimmen, wer als Mann ›zählt‹, ob wir unser Verständnis auf die Selbstidentifikation oder die soziale Zuschreibung oder die Geburtszuordnung stützen, wo verschiedene genderqueere und transsexuelle Menschen hineinpassen, und herauszufinden, wer wie ›sozialisiert‹ wurde. Und die Beendigung von Hierarchie und Entfremdung in all ihren Formen wird Strategien erfordern, die befreiender sind als Identitätspolitik. Aber seien wir realistisch: bestimmte Verhaltensmuster von unterdrückendem Verhalten und Macht passen oft ziemlich vorhersehbar mit Geschlechtergrenzen überein. Wenn genderspezifische Organisation dazu beitragen kann, diese Muster zu beseitigen, müssen wir vielleicht diesen Widerspruch annehmen und unser Bestes tun, um uns mit ihm in seiner ganzen chaotischen Komplexität auseinanderzusetzen.
Über die prinzipielle Problematik von gegenderter Organisierung hinaus, gibt es auch weitere möglicherweise problematische Aspekte an diesem Ansatz. Ohne die Vorstellung, dass es ›gute‹ anarchistische Männer gibt, die nicht die sexuellen Angreifer sind und über die wir uns folglich keine Sorgen machen müssen, bekräftigen zu wollen, können wir anerkennen, dass die Leute, die am meisten von der Auseinandersetzung mit ihrem sexistischen Verhalten profitieren könnten, wahrscheinlich am wenigsten geneigt sein werden, sich daran zu beteiligen.
Außerdem könnte die Teilnahme an einer formellen Männergruppe eine Möglichkeit für Sexisten sein, Legitimität zu erlangen. Um die Aufmerksamkeit von ihrem beschissenen Verhalten abzulenken, könnten sie einfach ihren ›antisexistischen Mitgliedsausweis‹ vorzeigen, wenn ihnen mal etwas vorgeworfen wird. Und wenn der Fokus auf genderspezifisches Organisieren Männergruppen, auch antisexistische, gegenüber autonomen Frauen- und/oder Trans-Organisationen privilegiert, könnte das die patriarchalen Machtverhältnisse in einer Szene eher stabilisieren als herausfordern.
Richtung 3: Nicht Verantwortungsübernahme, sondern Konfliktlösung
Unser Kampf um Verantwortungsübernahme leidet darunter, dass wir so wenig Modelle, Methoden oder Fähigkeiten zur Lösung von Konflikten untereinander haben. Es ist zwar bewundernswert, dass wir so viel Energie in die Ausarbeitung von Strategien für die Reaktion auf sexualisierte Gewalt investiert haben, aber es gibt unzählige andere Arten von Konflikten und problematischen Verhaltensweisen, für die wir ebenfalls Instrumente brauchen – und wie wir gesehen haben, sind die für sexualisierte Übergriffe spezifischen Methoden in anderen Situationen nicht angemessen. Was wäre, wenn wir dem Aufbau unserer Konfliktlösungs- und Mediationsfähigkeiten Vorrang einräumen würden?
Selbstverständlich gibt es spezifische Punkte, die für sexualisierte Gewalt relevant sind, und diese sollten nicht durch einen allgemeinen Fokus auf Konfliktlösung in den Hintergrund gedrängt werden. Aber wenn es einen Präzedenzfall, eine Sprache und Fähigkeiten gibt, um ein breites Spektrum von Konflikten und Verletzungen anzugehen, und wenn es üblich und weniger bedrohlich wird, an einem Konfliktlösungsprozess teilzunehmen, dann können wir vielleicht weniger defensiv reagieren, wenn wir erfahren, dass unsere Handlungen andere verletzt haben. Anstatt die Identitätspolitik von Überlebenden und Tätern auszuweiten, könnten wir eine nuanciertere Sprache schaffen, die die Menschen weder idealisiert noch dämonisiert, sondern uns alle auffordert, in lebenslangen Prozessen der Selbsttransformation engagiert zu bleiben. Dies erfordert Einfühlungsvermögen gegenüber Menschen, die Verletzungen angerichtet haben, damit wir einen Raum schaffen können, in dem sie sich ihr Verhalten eingestehen und heilen können.7
Welche Vorteile bietet es, Verantwortungsübernahmeprozesse bei sexualisierten Übergriffen in einen erweiterten Fokus auf Konfliktlösungen einzubinden? Es wäre keine Definitionshierarchie oder eine Form von Gradmesser erforderlich, um zu bestimmen, was als schwerer Übergriff oder Vergewaltigung ›zählt‹. Indem wir einen Präzedenzfall für kollektives Engagement bei weniger intensiven Konflikten schaffen, würden wir wertvolle Erfahrungen sammeln, die uns in Krisensituationen helfen könnten. Konfliktlösung als kollektive Verantwortung zu betrachten, könnte das Entstehen einer spezialisierten Gruppe von Menschen, die diese Prozesse stets ermöglichen, verhindern und es leichter machen, Unterstützer*innen mit ausreichendem Abstand zu einer Situation zu finden, um neutral vermitteln zu können. 8
Eine Warnung muss sehr deutlich gemacht werden: Mediation ist für viele Fälle von Gewalt in Partnerschaften nicht geeignet. Der Artikel »Thinking Through Perpetrator Accountability« stellt es so dar:
»Mediation sollte nicht als Ersatz für einen Prozess der Verantwortungsübernahme verwendet werden. Mediation ist für zwei Menschen, die einen Konflikt haben, der gelöst werden muss; Missbrauch hingegen geschieht einseitig. Bei Missbrauch geht es nicht darum, dass sich zwei Leute mal zusammensetzen und etwas klären müssten. Mediator*innen können sicherlich nützlich sein, um einige der konkreten Verhandlungen innerhalb eines Verantwortungsübernahmeprozesses zu erleichtern, aber bitte schlagt nicht eine Sitzung mit eine*r Mediator*in statt einer langfristigen Verpflichtung zu einem Prozess der Verantwortungsübernahme als Option vor.«
Berater*innen für Betroffene häuslicher Gewalt lernen, dass eine ›Paarberatung‹ in einer eindeutigen Situation des Missbrauches nicht durchgeführt werden sollte, da die Täter den Prozess in der Regel manipulieren und die missbräuchliche und ungleiche Dynamik, die der Beziehung zugrunde liegt, unbeachtet lassen. Dies ist wichtig im Hinterkopf zu haben, damit ein Wechsel zu einem Konfliktlösungsrahmen nicht auf Situationen missbräuchlicher Beziehungen angewendet wird.
Was gibt es an weiteren Nachteilen? Nun, es gibt immer noch das Problem, auf bestehende Probleme zu reagieren, indem mensch Lösungen vorschiebt, die Fähigkeiten oder Ressourcen erfordern, über die wir nicht verfügen. Was können wir in der Zwischenzeit tun, während wir langfristig lernen, wie wir unsere Konflikte lösen können? Betroffene könnten sich frustriert fühlen, wenn sexualisierte Gewalt mit weniger intensiven oder politisch unbedeutenderen Konflikten in einen Topf geworfen wird und so ihre Verletzungen heruntergespielt werden. Die Bitte an Betroffene, bei der Benennung der Täter eine weniger eindringliche Sprache zu verwenden, könnte die bestehenden Formen des ›Survivor Blamings‹ verstärken – in der Art, sie würden überreagieren und sexualisierte Übergriffe seien kein ausreichend wichtiges Thema, um ausdrücklich benannt zu werden. Außerdem könnten männliche ›Experten‹ in der Konfliktlösung die Unterstützungsarbeit für die Betroffenen übernehmen und von ihrem feministischen Fokus ablenken. Wir müssen den spezifischen Kontext sexualisierter Gewalt anerkennen, den Schmerz und die Wut der Betroffenen wahrnehmen und begleiten, Machtdynamiken erkennen und gleichzeitig das Spektrum der Konflikte, die wir angehen können, erweitern.
Richtung 4: Konzentrische Kreise der Affinität
»So etwas wie Verantwortungsübernahme gibt es in radikalen Communitys nicht, weil es so etwas wie Community nicht gibt – nicht wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Mach eine ehrliche Umfrage und du wirst sehen, dass wir uns nicht einig sind. Es gibt keinen Konsens. In diesem Kontext ist Community ein mythischer, oft beschworener und viel missbrauchter Begriff. Ich will kein Teil davon mehr sein.« — Angustia Celeste, »Safety is an Illusion: Reflections on Accountability«
Im Mittelpunkt all dieser Fragen steht ein ungelöstes Problem: Was ist ›Community‹? Bilden wir in eine gemeinsame Community als Anarchist*innen? Als Punks? Als Personen einer bestimmten lokalen Szene? Weil wir auf denselben Demos, Konzerten oder Massenaktionen sind? Suchen wir uns aus, Teil davon zu sein, oder sind wir es, ob wir wollen oder nicht, unabhängig davon, wie wir uns selbst identifizieren? Und wer entscheidet das alles?
Es kann keine Community Accountability ohne Community geben. Der gesamte Rahmen transformativer Gerechtigkeit fällt ohne ein kohärentes Gefühl dafür, was Gemeinschaft bedeutet, auseinander. Aber leider scheint keine*r in der Lage zu sein, diese Frage für unser Milieu zu beantworten. Und ohne Antwort rennen wir immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand, wenn ein schleimiger Angreifer einfach die Stadt verlässt oder nach der Bloßstellung die Szene verlässt, oder wenn einer in einer Szene genug Macht ausübt, um die Grenzen der Gemeinschaft so weit zu verschieben, dass Betroffene und Verbündete ausgeschlossen werden. Dies ist keine abstrakte Frage: Sie ist grundlegend für das, was wir tun und wie die Macht in unseren Szenen funktioniert.
Die Gemeinschaft wird konkret durch spezifische Institutionen, wie Websites, Versammlungen, Soziale Zentren und Hausprojekte, die die nordamerikanische (und auch die europäische) anarchistische Szene ausmachen. Obwohl keine Anwesenheitsliste geführt wird (außer vielleicht durch das FBI) und viele von uns darüber streiten, wer als echte*r Anarchist*in gilt, haben diejenigen von uns, die sich durch diese Räume bewegen, das Gefühl, Teil von etwas zu sein. Wir weben dieses sinngebende Gefühl durch gemeinsame Praktiken zusammen, die uns als Teamkolleg*innen kennzeichnen: Kleidungs- und Körpermodifikationen, Eigenarten in der Ernährung und Hygiene, Gespräche in eigener Fachsprache und mit entsprechenden Bezugspunkten.
Aber reicht die Zugehörigkeit zu einem anarchistischen ›Milieu‹ als Grundlage für die Art von Gemeinschaft aus, die bei Community-Accountability-Prozessen erforderlich ist? Können wir diese Modelle realistisch auf unsere diffusen, fragmentierten, meist unstrukturierten Assoziationen von Außenseiter*innen anwenden?
Während wir uns durch unser Leben bewegen und uns in Verbindungen mit Freunden*, Nachbarinnen und Gefährtinnen bewegen, sind wir nicht nur Teil einer einzigen, einheitlichen Gemeinschaft und auch nicht eines Netzes aus mehreren Gemeinschaften. Vielmehr nehmen unsere Beziehungen zu anderen die Form von konzentrischen Kreisen der Affinität an. Daraus können wir ein vorläufiges Modell ableiten, um uns vorzustellen, wie man Modelle der Community Accountability auf anarchistische Szenen anwenden kann.
Einer der größten Mängel in unserer Vorstellung von anarchistischer Gemeinschaft liegt in ihrer Natur als impliziert und angenommen, und nicht als expliziert und artikuliert. Oftmals geben wir unsere Verpflichtungen und Erwartungen an die anderen Menschen, mit denen wir verschiedene Arten von ›Gemeinschaft‹ teilen, nicht direkt an, es sei denn, es handelt sich um spezifische Projekte oder Kollektive. Beispielsweise verpflichten sich die Mitbewohner*innen durch das Zusammenleben, Rechnungen pünktlich zu bezahlen, das Geschirr zu spülen und den Raum des anderen zu respektieren. Was wäre, wenn wir dieses Maß an expliziter Absprache auf alle unsere Beziehungen ausdehnen würden? Unmöglich: Wir sollen uns mit allen Anarchist*innen in Europa / Nordamerika – oder auch nur in unserer Stadt – einzeln zusammensetzen und explizite Standards dafür festlegen, wie wir miteinander umgehen und was wir voneinander erwarten?
Nein, selbstverständlich nicht … und genau darum geht es. Das können wir nicht tun, also müssen wir herausfinden, wie wir diese Dinge innerhalb der verschiedenen Beziehungsgeflechte in unserem Leben kollektiv bestimmen können. Anstatt von einer ›Gemeinschaft‹ auszugehen und zu versuchen, die Menschen auf der Grundlage dieser Fiktion zur Verantwortungsübernahme zu bringen, sollten wir unsere Erwartungen und Verpflichtungen gegenüber den anderen in unseren verschiedenen Kreisen der Affinität definieren und sie als Grundlage für unsere Reaktionen auf Konflikte und Verletzungen verwenden.
Sagen wir zum Beispiel, dass mein innerster konzentrischer Kreis meine Bezugsgruppe ist. Dies sind die Leute, denen ich am meisten vertraue, mit denen ich Risiken eingehe und für die ich alles tun werde, was nötig ist. Ich wäre bereit, diese Menschen im Zweifelsfall bei der Lösung von Konflikten und dem Umgang mit Verletzungen weit mehr als alle anderen Menschen zu unterstützen. Nach diesem Modell würde ich mich mit meiner Bezugsgruppe zusammensetzen und präventiv diskutieren, wie mensch Konflikte miteinander angeht, wenn sie auftauchen, von den kleinsten bis hin zu den schwerwiegendsten Streitigkeiten und Formen der Verletzung. Betrachten wir es als eine Art Ehevertrag für Freunde und Gefährtinnen, der die Grundlage für den Fall ist, dass etwas schiefgehen sollte. Auf diese Weise habe ich ein klares Gespür dafür, wie ich reagieren muss, wenn einer aus meiner Crew sich verletzend mir gegenüber verhält, und eine gemeinsame Vertrauensbasis für die Zusammenarbeit mit ihnen in einem möglicherweise langfristigen Transformationsprozess. Ich würde dieses Vertrauen zwar nicht auf die meisten Menschen ausdehnen, aber innerhalb dieser Gruppe teilen wir eine tiefe und ausdrückliche Affinität, sodass ich für Kritik, Vorwürfe und Veränderungen offen sein werde, während ich gleichzeitig das Vertrauen habe, das auch meine Gefährt*innen es gegebenenfalls sein werden. Andere Beispiele für diesen innersten Kreis der Affinität können Familien (geboren oder ausgewählt), Haus- und Landprojekte, verschiedene Arten von Kollektiven oder eng verbundene Gruppen von Freund*innen sein.
Der nächste Kreis nach außen könnte ein geteilter Gemeinschaftsraum sein, wie z.B. ein Infoladen oder ein Soziales Zentrum. Es ist eine ziemlich beständige Gruppe von Leuten, von denen einige mir näherstehen als andere, aber auch ein offener Raum, sodass Leute kommen können, die ich nicht kenne. Da es sich nicht um eine völlig feste Gruppe handelt und sich nicht alle einzelnen Personen auf direkte Vereinbarungen miteinander einigen können oder würden, kann es kollektive Vereinbarungen über Respekt, Zustimmung, Hierarchiefreiheit, Nutzung von Ressourcen und dergleichen geben. Diese müssen nicht autoritär sein; sie können kollektiv festgelegt und jederzeit mit der Zustimmung der am stärksten Betroffenen revidiert werden, und keine*r ist gezwungen, sich an sie zu halten; Leute, die nicht können oder wollen, können sich dafür entscheiden, nicht an dem Raum teilzunehmen. Daher wäre ich bereit, mich dem Versuch anzuschließen, eine Person zur Verantwortungsübernahme zu bringen, sofern sie sich weiterhin an dem Raum beteiligen will. Da das, was unsere ›Gemeinschaft‹ definiert – die Bedingungen unserer Affinität zueinander –, unsere gemeinsame Erfahrung der Teilnahme an diesem Raum ist, sind wir, wenn einer von uns nicht mehr daran teilnimmt, nicht mehr in Gemeinschaft miteinander und sollten daher nicht erwarten, dass wir dadurch zur Verantwortung gezogen werden oder andere zur Verantwortung gezogen werden. Und dementsprechend gibt es für den Fall, dass einer gegen die kollektiven Standards verstößt oder sich weigert, diese einzuhalten, ein Verfahren, mit dem einer für seine Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden kann; und wenn er sich weigert, können andere ihn guten Gewissens aus dem Raum ausschließen. Andere Beispiele für diesen zweiten Kreis der Affinität könnten spezifische Veranstaltungen, größere Organisationsprojekte und Leute sein, die sich locker in gemeinsamen sozialen Räumen aufhalten.
Dieser Rahmen konzentrischer Affinitätskreise hilft uns, uns vorzustellen, wo wir die Praktiken der Community Accountability, mit denen wir in den letzten Jahren unter Anarchist*innen experimentiert haben, am besten anwenden können. Je weiter sich die Kreise nach außen hin zu Massenmobilisierungen, übergreifenden Gruppen wie Anarchist*innen oder Punks und unserer breiteren radikalen ›Gemeinschaft‹ bewegen, desto schwieriger ist es, sich vorzustellen, wie wir Gemeinschaft konkret definieren und in ihr Verantwortung übernehmen könnten. Es gibt keinen Grund, von einer Person zu erwarten, dass sie uns gegenüber ›verantwortlich‹ ist – unabhängig davon, welche abstrakte Ebene wir angeblich mit ihr teilen. Ohne eine konkrete Grundlage hat unsere ›Gemeinschaft‹ weder Zuckerbrot noch Peitsche; wir können die Menschen nicht dafür belohnen, dass sie unseren Forderungen nachkommen, und wir können sie auch nicht dazu zwingen, dies zu tun. Wenn also eine beliebige Person, die angeblich ein Anarchist ist, sich übergriffig verhält, ist es vielleicht nicht realistisch, auf diese Situation mit Community-Accountability-Prozessen zu reagieren.
Was machen wir dann? Die Bullen rufen, sie verprügeln, sie aus allen Einrichtungen vertreiben, die von Leuten kontrolliert werden, mit denen wir Affinitäten teilen? Und wie gehen wir mit dem immer wiederkehrenden Problem von Menschen um, die eine Szene verlassen, nur um in einer anderen wieder übergriffiges Verhalten zu zeigen? Wir haben keine klaren Antworten. Aber wir müssen damit beginnen, in jedem Kreis der Affinität Diskussionen über unsere Voraussetzungen des Engagements zu führen. Aber auch Diskussionen darüber, wie wir Verletzungen angehen und Konflikte lösen können, bevor wir uns in einer Krise wiederfinden und gezwungen sind, Antworten zu finden, während wir handeln. Solange wir das nicht in jedem Kollektiv, in jedem Raum, in jeder sozialen Gruppe und in jeder anderen anarchistischen Gruppierung gründlich gemacht haben, können wir realistischerweise keine formelle Community Accountability als Strategie für den Umgang mit »unserer Scheiße« anstreben.
Die Bildung von Bezugsgruppen ist ein entscheidender Teil des anarchistischen Organisierens. Es kann so einfach sein, wie eine Crew von Freund*innen zusammenzuziehen, um eine Aktion durchzuführen, oder so formell und strukturiert, wie du es dir nur vorstellen kannst. Dabei wird auch das elementare anarchistische Grundprinzip der freiwilligen Vereinigung bewahrt: die Idee, dass wir mit wem wir wollen, ohne Zwang oder Bürokratie machen können, was wir wollen. Dieser einfache Prozess ist der Kern unserer Aktionen bei Demos und Massenmobilisierungen, aber vielleicht können wir ihn nutzen, um unsere gesamte anarchistische Gemeinschaft und unser Milieu zu konzeptualisieren. Wenn es uns gelingt, stärkere Bindungen miteinander zu schaffen und unsere Affinitäten konkreter zu verstehen, haben wir vielleicht die Grundlage dafür, Community Accountability zu etwas mehr als nur einem vagen und umstrittenen Traum zu machen.
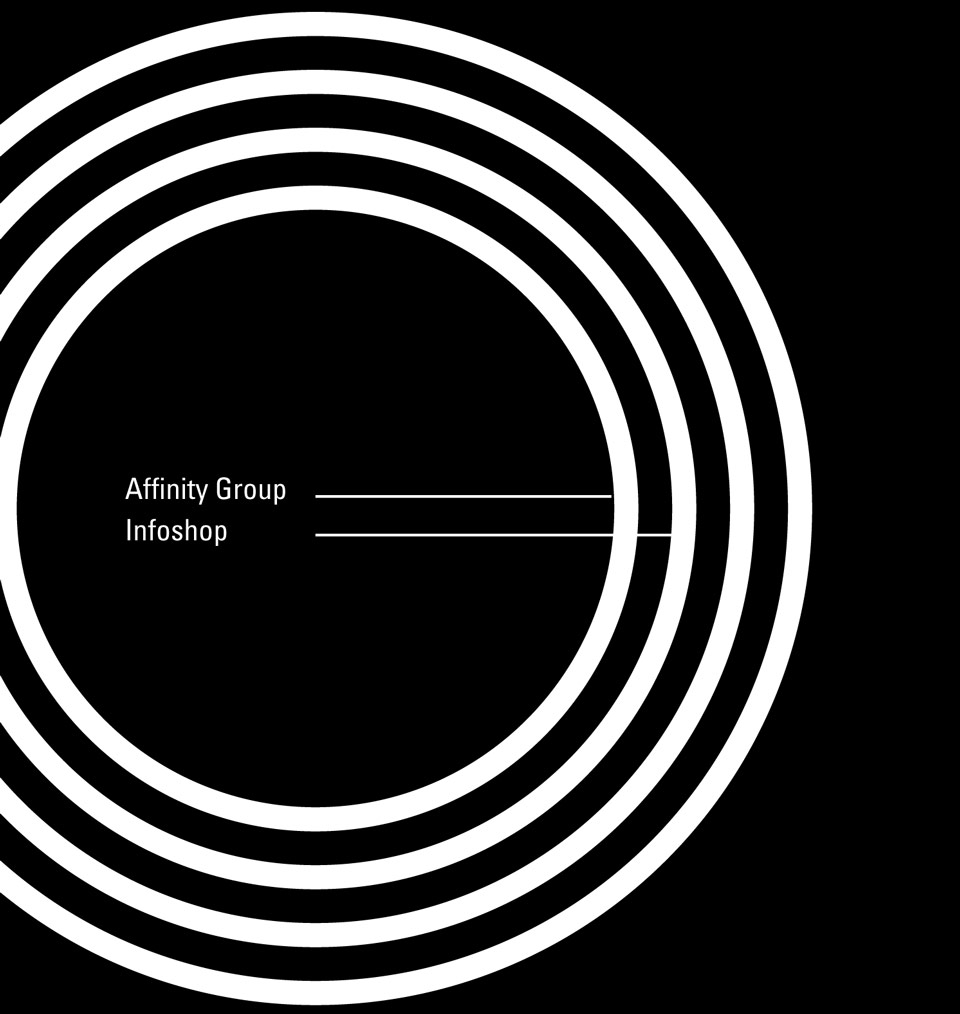
Wir hoffen, dass dieser Aufsatz zur Selbstreflexion unter Anarchist*innen darüber beitragen wird, wo unsere Affinitäten wirklich liegen. Vielleicht können wir viele der Schwierigkeiten unserer bisherigen Experimente mit Community-Accountability-Prozessen angehen, indem wir unsere gegenseitigen Erwartungen und Verpflichtungen so explizit wie möglich machen. Wir können auch erwägen, den von Betroffenen geführten Vigilantismus auszuweiten, antisexistische Männergruppen und genderspezifische Organisationen auszubauen, um der Rape Culture den Boden zu entziehen, oder unsere Schwerpunkte auf Konfliktlösung und Mediation erweitern. Welchen Weg wir auch immer wählen, Anarchist*innen müssen weiterhin alles versuchen, um die ausweglosen Situationen in Bezug auf sexualisierte Gewalt in unseren Szenen zu durchbrechen. Unsere Befreiung hängt davon ab.
Anhang
Weiterlesen:
- e*vibes: »Wir arbeiten nicht mit Definitionsmacht«
- zur Auseinandersetzung mit Männlichkeit: Boykott Magazin
- Zine: Konsens lernen
Dieser Beitrag als Audio
online und Download auf soundcloud
online und Download auf soundcloud
Der englische Anhang:
Zitierte Texte
- “An Internal Action of the Vaginal Liberation Front”, in Men in the Feminist Struggle
- “Don’t Believe the Hype”
- Fight Rape! Six Years of Men’s Group and Accountability Work by Dealing With Our Shit
- “IMF Resistance Network Consent Guidelines: No Perpetrators Welcome”
- “i. communique” by Radical Women’s Kitchen
- “Is the Anarchist Man Our Comrade?”
- “Kafka sales will be through the roof at the NYC Anarchist Book Fair”
- “Notes on Survivor Autonomy and Violence”
- “Safer Space Policy,” by NYC Anarchist Book Fair Collective
- “Safer spaces, false allegations, and the NYC Anarchist Book Fair”
- “Safety is an Illusion: Reflections on Accountability” by Angustia Celeste, in It’s Down To This: Reflections, Stories, Critiques, Experiences, and Ideas on Community and Collective Response to Sexual Violence, Abuse and Accountability
- “Sexual Assault and Consent Policy” by Toronto Anarchist Book Fair Collective
- Supporting a Survivor of Sexual Assault by Men Against Rape Culture.
- “Thinking Through Perpetrator Accountability,” in Rolling Thunder #8
- “We Are All Survivors, We Are All Perpetrators,” in Rolling Thunder #1
Gruppen und Organisationen
- Generation Five (Oakland, CA)
- Philly Stands Up (Philadelphia, PA)
- Creative Interventions (San Francisco, CA)
- INCITE! Women of Color Against Violence (national)
- Audre Lorde Project – Safe OUTside the System (Brooklyn, NY)
- Critical Resistance (national)
- Support New York (New York City)
Bücher
- The Color of Violence: The INCITE! Anthology, by INCITE! Women of Color Against Violence
- The Revolution Starts at Home: Confronting Partner Abuse in Activist Communities, edited by Ching-In Chen, Jai Dulani, Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha and Andrea Smith
- Instead of Prisons: A Handbook For Abolitionists, by Prison Research Education Action
- Peacemaking Circles: From Crime to Community, by Kay Pranis
Zines
- It’s Down to This: Stories, Critiques and Ideas on Community and Collective Response to Sexual Violence and Accountability
- What Do We Do When #2 and #3
- An Activist Approach to Domestic Violence
- Thoughts About Community Support Around Intimate Violence
- See No, Speak No, Hear No
- Alternatives to Police by Rose City Copwatch
- Learning Good Consent, auf deutsch
- Support
- World Without Sexual Assault
- Let’s Talk About Consent, Baby
- Our Own Response
- A Stand-Up Start Up: Confronting Sexual Assault with Transformative Justice
- Beautiful, Difficult, Powerful: Ending Sexual Assault Through Transformative Justice
- Conflict Resolution Circles
- As If They Were Human: A Different Take on Perpetrator Accountability
- Revolution in Conflict: Anti-Authoritarian Approaches to Resolving and Transforming Conflict and Harm
- For a Safer World
Weitere Quellen
- Creative Interventions Toolkit
- Toward Transformative Justice, by Generation Five
- Community Accountability Principles/Concerns/Strategies/Models
- Community Accountability Within People of Color Progressive Movements
- Hollow Water (documentary film), by Bonnie Dickie
- Ideas, Actions, Art, & Resources for Communities Responding to & Transforming Violence
- Conflict Resolution Information
- Restorative Justice Information Clearinghouse
- International Institute for Restorative Practices
- Policies for Mass Mobilizations around Sexual Assault and Consent:
PDF Downloads
- Printable ’zine (PDF; 750 KB)
- Online reading ’zine version (PDF; 450 KB)
Übersetzung aus dem Buch Writings on the Wall
-
Im Verlauf des Textes taucht die Community Accountability (CA) sehr häufig auf, oftmals haben wir sie mit ›Prozessen der Verantwortungsübernahme‹ oder ähnlichem umschrieben. Dies gilt der besseren Lesbarkeit und sollte hoffentlich aus dem Kontext heraus verständlich sein. (Anm. d. Übers.) ↩
-
Umfangreiches Überwachungs-, Diskreditierungs- und Zersetzungsprogramm des FBI zwischen den 1950er und 1970er Jahren gegen linke Personen und Zusammenhänge. ↩
-
Die kritische Auseinandersetzung mit Verboten und Ausgrenzung als primäre Taktik in solchen Prozessen wirft weitere heiklere Fragen darüber auf, wie die Forderungen der Betroffenen zu bewerten sind, und zwar nicht nur im Hinblick auf unsere Fähigkeit, sie zu erfüllen, sondern auch auf unsere Bereitschaft, dies zu tun. Besteht unsere Rolle als Befürworter*innen anarchistischer Community-Accountability-Prozesse lediglich darin, an den Forderungen einer Betroffenen festzuhalten, auch wenn wir mit ihnen strategisch oder ethisch nicht einverstanden sind? Ein*e Verbündete*r zu sein, kann dadurch definiert werden, das zu tun, was die Betroffene will, egal was es ist. Aber wir glauben, dass es keine Befreiung geben kann, die aus der Aussetzung unserer ↩
-
Manchmal haben Menschen, die ehrlich versuchen, Verantwortung zu übernehmen, anarchistische Szenen ganz verlassen, um einer Betroffenen Raum zu geben. Das ist zwar besser, als nicht zu kooperieren, untergräbt aber das Ideal der transformativen Gerechtigkeit, das darin besteht, die Menschen als Teil einer Gemeinschaft zu halten. ↩
-
Eine häufige Herausforderung ist, wenn sich einer nicht klar daran erinnert, was bei einer Begegnung, zu der ihm etwas vorgeworfen wird, passiert ist, oder wenn er sich an die Erfahrung anders erinnert, als die Person, die ihm etwas vorwirft, sich daran erinnert. Eine Betroffene mag davon ausgehen, dass dies nur ein Trick ist, um sich der Verantwortung zu entziehen, was möglicherweise auch stimmt; aber oft stimmen die Erinnerungen der Menschen einfach nicht überein. Wenn diese Prozesse keine pseudo-juristischen Versuche sind, ›die Wahrheit‹ dessen zu ermitteln, was ›wirklich passiert ist‹, wie es von irgendeiner Autorität bestätigt wird, wie können wir dann diese Unterschiede in Einklang bringen? Müssen die Erinnerungen aller Parteien übereinstimmen, damit die Forderungen legitim sind? Kann einer die Verantwortung für Dinge übernehmen, an die sie*er sich nicht mehr erinnern kann?
Aus unserer Erfahrung heraus ist es ein wichtiger erster Schritt, bei Menschen, denen etwas vorgeworfen wird, zu intervenieren und anzuerkennen, dass eine*r die Realität vielleicht anders erlebt als sie. Wir können sie zum Beispiel auffordern, zuzugeben, dass etwas, das sie als einvernehmlich erlebt haben, von einem anderem vielleicht nicht auf diese Weise erlebt wurde. Die aufrichtige Entschuldigung, die eine Überlebende sucht, ist möglicherweise nicht möglich, wenn sich die Person, der etwas vorgeworfen wird, nicht auf die gleiche Weise an eine Interaktion erinnert. Dennoch kann die Annahme, dass sich die andere möglicherweise durch etwas verletzt gefühlt hat, einen dafür öffnen, einige seiner Verhaltensweisen zu untersuchen und zu ändern, wenn er schon nicht die volle Verantwortung übernimmt. ↩
-
Es ist schwierig, dies anzuerkennen, ohne in sprachliche Verharmlosung und Verleugnung abzugleiten, die so oft benutzt wird, um Betroffene zum Schweigen zu bringen. Wir wollen nicht, dass Reaktionäre dies in ihr Arsenal der Verleugnung aufnehmen: »Sie nutzen diesen Trend der ›Accountability‹ nur, um Macht zu erlangen, selbst wenn die Situation gar nicht dazu passt«, und so weiter und so fort. Dennoch müssen wir in der Lage sein, darüber offen zu reden und daraus zu lernen, um effektiver auf sexualisierte Gewalt reagieren zu können. ↩
-
Wie ein selbst-bezeichneter Täter in einem Kommentar zu »Notes on Survivor Autonomy and Violence« schreibt: »Ich sage nicht, dass die Betroffenen Mitgefühl für die Menschen empfinden müssen, die ihnen Gewalt angetan haben. Aber wenn wir Gemeinschaften aufbauen wollen, die das Patriarchat tatsächlich überleben können, anstatt von ihm atomisiert und zu Staub geschlagen zu werden, denke ich, dass eine*r Einfühlungsvermögen für die Täter haben muss. Aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass ich nie den Mut gehabt hätte, mich zu meiner Scheiße zu bekennen und damit umzugehen, wenn ich nicht ein paar Leute gefunden hätte, die sich wirklich um mich kümmerten und einen Weg gefunden haben, mir Einfühlungsvermögen zu zeigen… Und ich glaube nicht, dass Einfühlungsvermögen bedeutet, für eine andere Person Ausreden zu erfinden. In diesem Zusammenhang bedeutet es meiner Meinung nach, ihn sich nicht entschuldigen zu lassen, ihn nicht vor seiner Verantwortung und seiner Geschichte entkommen zu lassen und sicherzustellen, dass er sich den Konsequenzen seiner Handlungen stellt. Es bedeutet auch, ihm aufrichtig zuzuhören, selbst wenn man dies tut und nach Verständnis sucht. Und ich glaube, es bedeutet, dafür zu sorgen, dass die Täter zwar Konsequenzen für ihre Handlungen spüren, aber keine Strafen. Es bedeutet auch, Ressourcen zu finden, damit der Täter erst lernen und dann ein anderes Muster von Gewohnheiten und Handlungen einüben kann… Ich glaube, dass Verantwortungsübernahmeprozesse Empathie benötigen. Empathie und Wut, zur selben Zeit.« ↩
-
Es lohnt sich zu fragen, ob ›Neutralität‹ in der Konfliktvermittlung möglich oder wünschenswert ist oder nicht. In vielen Konflikten übt eine Partei mehr Macht aus als die andere, und wenn nicht versucht wird, in diese Machtdynamik einzugreifen, kann Neutralität oft auf Komplizenschaft mit der Macht hinauslaufen. Ein alternatives Modell zur Neutralität eines Mediators gegenüber den Konfliktparteien ist die ›Zwei-Parteilichkeit‹. In diesem Rahmen setzt sich eine Mediatorin für beide Parteien ein, fordert sie aber auch heraus, wenn sie ihren Zugang zur Macht innerhalb des Konflikts ausnutzen, indem sie sie bittet, zu überlegen, auf welche Weise ihre Macht sie für die Erfahrungen derer, denen diese Macht fehlt, blind macht. ↩

